Unisonar S7|EP6: Wie treffen wir Entscheidungen?
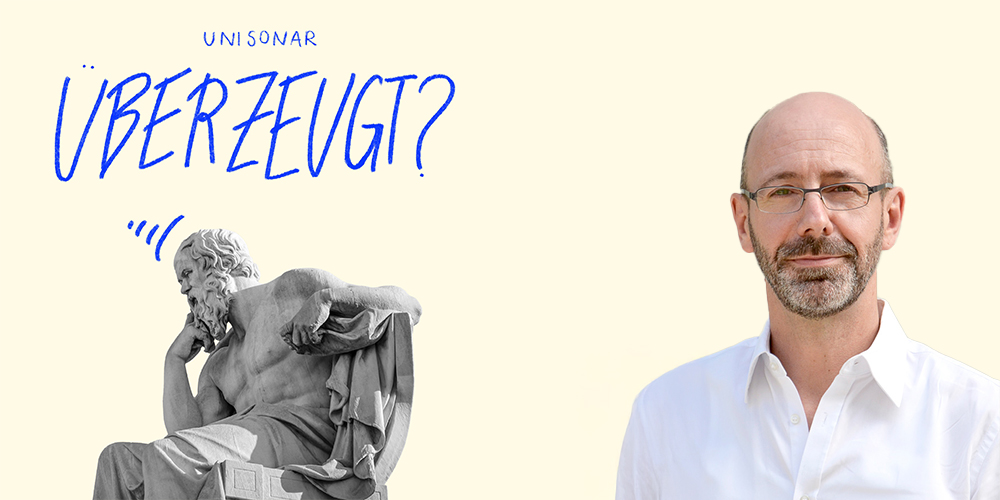
Warum greifen wir im Supermarkt oft zu denselben Produkten? Wieso wirken drei Optionen überzeugender als eine? Und wie beeinflusst unser Sicherheitsbedürfnis Anlageentscheidungen für die Altersvorsorge? Der Psychologe Jörg Rieskamp erklärt, wie Menschen Entscheidungen treffen, wie Erfahrungen und Verlustängste unser Verhalten steuern und warum ökonomische Theorie oft wenig mit Realität zu tun hat.
Im Alltag treffen wir laufend Entscheidungen, viele davon scheinbar beiläufig. Doch was beeinflusst unsere Wahl? Professor Jörg Rieskamp erklärt, dass Intuition oft auf einem Fundament aus früheren Erfahrungen basiert. «Wir haben sehr viele Erfahrungen gemacht mit vielen Produkten. Und viele kaufen wir einfach, weil wir sie immer kaufen.»
Diese Routine helfe, schnelle Entscheidungen zu treffen, ohne sie bewusst reflektieren zu müssen. Wenn diese Routinen gestört würden, etwa weil ein vertrautes Produkt fehlt, beginnt ein aktiver Vergleichsprozess.
Vergleiche statt objektiver Bewertung
Die ökonomische Theorie geht davon aus, dass Menschen Produkte unabhängig voneinander bewerten. In der Realität vergleicht man jedoch Alternativen direkt miteinander. Ein Beispiel: Drei Smartphones mit unterschiedlichen Preisen und Funktionen führen oft dazu, dass die mittlere Variante bevorzugt wird, weil sie im Verhältnis vernünftig erscheint.
«Eigentlich würde uns die Ökonomie raten, wir sollten Produkte unabhängig voneinander vergleichen», sagt Rieskamp. Doch Menschen lassen sich durch Kontexte und Kontraste stark beeinflussen.
Verlustangst beeinflusst Entscheidungen massiv
Ein zentrales psychologisches Muster ist die Angst vor Verlusten. Menschen reagieren deutlich sensibler auf Einbussen als auf gleichwertige Gewinne. Dies zeigt sich etwa bei Gehaltsverhandlungen: Wird ein niedrigeres Gehalt als zuvor angeboten, wird das als Abwertung empfunden, selbst wenn das neue Angebot objektiv fair wäre. «Wenn wir unsere Ressourcen wieder verlieren, würde das eine Einschränkung unserer Möglichkeiten im Leben beinhalten», erklärt Rieskamp. Diese Verlustvermeidung ist tief in unseren Erfahrungen verankert.
Besonders bei der Geldanlage zeigt sich die Tendenz zur Risikoaversion deutlich. Viele Menschen legen ihr Geld lieber sicher auf ein Konto, obwohl risikoreichere Anlagen langfristig höhere Erträge versprechen. Der Grund: kurzfristige Schwankungen und mögliche Verluste werden überbewertet.
«Auch wenn wir das Geld erst im Ruhestand bekommen, schauen wir gar nicht so weit in die Zukunft, sondern bewerten kurzfristig», so Rieskamp. Diese Kurzsichtigkeit verhindert oft rational sinnvolle Entscheidungen.
Risikofreude ist nicht automatisch klüger
Nicht alle Menschen sind gleich vorsichtig. Es gibt auch risikofreudige Anleger, die Verluste weniger stark gewichten und auf ihre Einschätzungen vertrauen. Das führt nicht immer zu besseren Ergebnissen. «Diese Zuversicht ist in der Regel nicht gerechtfertigt», warnt Rieskamp.
Besonders problematisch ist es, wenn einzelne Aktien statt breit gestreuter Fonds gewählt werden. Wissen kann zwar helfen, überschätzte Kompetenz jedoch zu riskanten Entscheidungen führen.
In Ländern wie den USA liegt mehr Verantwortung für die Altersvorsorge bei den Einzelnen. In der Schweiz ist die Freiheit in der Säule 3a begrenzt. Laut Rieskamp muss der Staat abwägen: «Soll ich in einem bestimmten Bereich eingreifen und reglementieren?» Unregulierte Entscheidungsfreiheit birgt Risiken, wenn Wissen oder Urteilsfähigkeit fehlen. Falsche Entscheidungen betreffen nicht nur Einzelpersonen, sondern haben auch gesellschaftliche Auswirkungen.
Informierte Entscheidungen statt spontane Reaktion
Jörg Rieskamp plädiert dafür, sowohl auf Intuition als auch auf fundierte Informationen zu setzen. Entscheidungen sollten sich auf Erfahrungen stützen, aber in neuen oder komplexen Situationen lohnt sich eine gründliche Auseinandersetzung mit Alternativen.
«Wenn Sie Dinge verändern wollen, dann ist es sinnvoll, sich ausführlich zu informieren», rät er. So lassen sich bessere Entscheidungen treffen, die sowohl kurzfristige Gefühle als auch langfristige Konsequenzen berücksichtigen.







