Unisonar S7|EP1: Manipulation, Lüge und die Macht der Erzählung
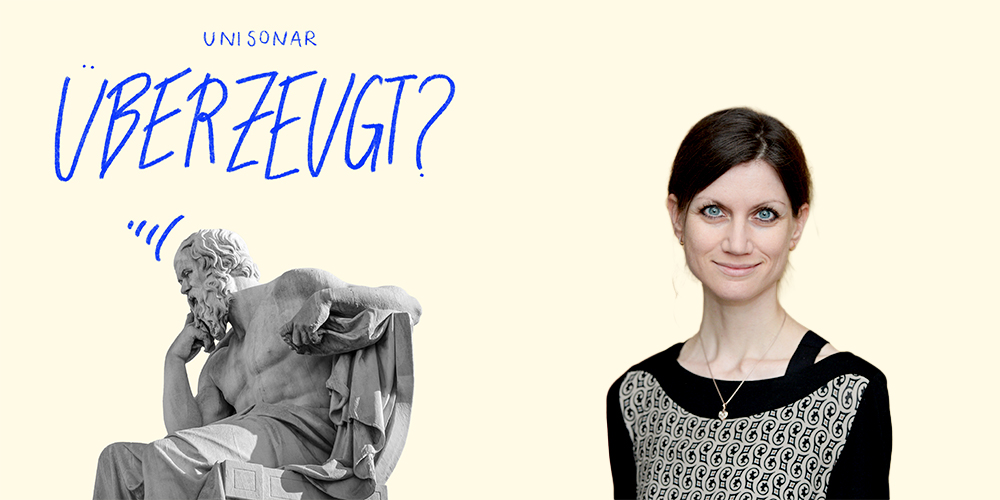
Wann werden wir manipuliert – und wie können wir es erkennen? Die Literaturwissenschaftlerin Lea Liese spricht in der ersten Folge der «Überzeugt?»-Staffel über Täuschung, Anekdoten, Fake News und mediale Wirkmechanismen von gestern und heute.
Manipulation und Täuschung sind seit jeher zentrale Themen der Literatur. Ob Shakespeares «Othello», Laclos' «Gefährliche Liebschaften» oder Orwells dystopischer Roman «1984» – literarische Werke bedienen sich dieser Mittel, um Konflikte zu erzeugen, Machtverhältnisse zu hinterfragen und die Handlung voranzutreiben.
Die Literaturwissenschaftlerin Lea Liese erklärt im Gespräch, dass Manipulation Leserinnen und Leser emotional stark einbindet: «Manipulation und Täuschung schüren in jedem Fall Konflikte, treiben die Handlung voran und bewirken eine Zustandsveränderung.» Gleichzeitig reflektiert Literatur die Mechanismen von Manipulation, macht sie sichtbar und analysierbar.
Die Grenzen zwischen Literatur und Berichterstattung waren historisch nicht immer klar. Besonders um 1800 wurde erstmals intensiv darüber diskutiert, welche Inhalte als Tatsachenberichte gelten dürfen.
Damals war es üblich, Anekdoten und kleine erfundene Geschichten in Zeitungen zu veröffentlichen – oft als verklausulierte Kritik unter den strengen Zensurbedingungen der napoleonischen Zeit. «Man hat nicht so streng unterschieden zwischen Anekdoten, kleinen Erzählungen und Zeitungsberichten», erzählt Lea Liese. Die Vermischung von Realität und Erfindung wurde dabei teilweise bewusst in Kauf genommen – sowohl aus politischen als auch aus unterhaltenden Gründen.
Fake News: Das postfaktische Zeitalter
Ein zentrales Thema des Gesprächs ist das moderne Phänomen der Fake News. Lea Liese sieht hierin ein bedenkliches Moment: Es gehe nicht nur um gezielte Unwahrheiten, sondern um die grundsätzliche Aufhebung der Unterscheidbarkeit von Wahrheit und Lüge. «Das neue und auch durchaus bedenkliche Moment an Fake News ist, dass hier Lüge und Wahrheit ununterscheidbar gemacht werden sollen.» Ziel sei es, gezielt Verwirrung zu stiften und dadurch die gesellschaftliche Debatte zu untergraben.
Urban Legends dagegen funktionieren wie moderne Anekdoten: Sie behaupten Nähe, erzeugen Authentizität und bedienen oft emotionale oder angsterzeugende Themen. Geschichten über Einwanderer, die Haustiere essen, kursieren seit Jahrhunderten in verschiedenen Ländern und Kontexten – stets angepasst an das jeweilige Feindbild der Zeit. Diese Geschichten wirken umso stärker, weil sie vertraute Erzählstrukturen mit tief sitzenden Emotionen verknüpfen.
Verantwortung von Medien, Politik und uns selbst
Am Ende stellt sich die Frage: Wie können wir uns vor Manipulation schützen? Liese sieht eine gemeinsame Verantwortung bei Medien, Politik und Gesellschaft. Es brauche Sorgfalt, Medienkompetenz und ein bewusstes Innehalten vor dem Weiterverbreiten von Informationen. Die Geschichte zeige: Manipulation war nie völlig abwesend – aber das kritische Lesen, Fragen und Einordnen bleibt unsere stärkste Waffe.







