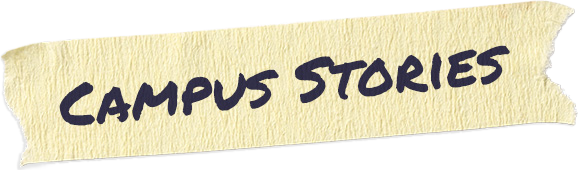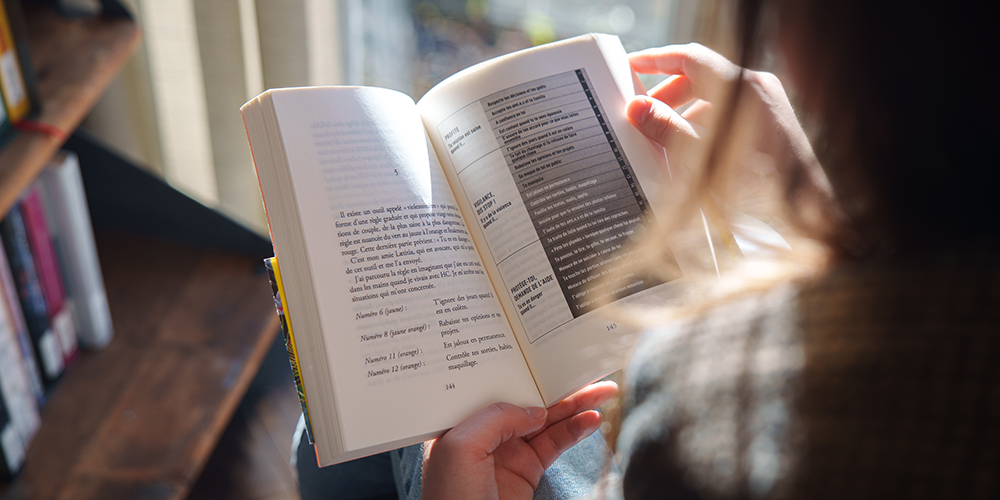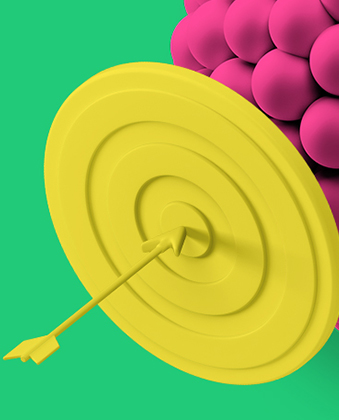Seminare mit Perspektiven: Die Soziologie blickt nach vorne

Was soll ich studieren? Wie wollen wir zukünftig leben? Wer bestimmt eigentlich, wohin sich die Gesellschaft bewegt? Wir beschäftigen uns täglich mit Zukunftsvorstellungen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Die Ungewissheit bringt Ängste, aber auch hoffnungsvolle Entwürfe. In drei Seminaren der Soziologie an der Universität Basel beschäftigen sich die Studierenden mit den vielseitigen Perspektiven auf das Kommende.
Kaum ein Thema beschäftigt uns so sehr wie das, was noch kommt. Wir spekulieren über die Klimakrise, technologische Umbrüche und persönliche Lebenswege. Die Frage nach dem Morgen prägt unseren Alltag.
Auch die Soziologie interessiert sich für diese Perspektiven. Sie untersucht, was unsere Annahmen über das Kommende über unsere gesellschaftlichen Strukturen verrät und wie sie unsere Beziehungen verändern.
Im aktuellen Semester blickt der Fachbereich Soziologie der Universität Basel gleich in drei Lehrveranstaltungen auf solche neuen und alten Debatten. Helene Thaa, Robert Schäfer und Mirela Ivanova beleuchten mit den Studierenden in ihren Seminaren unterschiedliche Ansätze, um die Zukunft und aufkommende Fragen soziologisch zu betrachten.
Zwischen Zuversicht und Zweifel
Im Seminar «Soziologie der Zukunft zwischen Fortschritt und Katastrophe» beschäftigt sich Helene Thaa gemeinsam mit den Studierenden mit der Frage, wie sich unser Verhältnis zu Zukunft verändert hat. Thaa diskutiert mit den Studierenden, welche gesellschaftlichen Entwicklungen und Strukturen die Beziehung zu Zeit und den Blick auf die Zukunft prägen.
«Früher war die Idee verbreitet, dass die Zukunft planbar ist», erklärt Thaa. «Unsere Vorstellung war angetrieben von technischem Fortschritt und wirtschaftlichem Wachstum». Im Seminar wird diskutiert, warum diese Zuversicht ins Wanken geraten ist. Was vorher noch in der breiten Gesellschaft Anlass zu Hoffnung gab, löst heute Angst und Unsicherheit aus. Die Studierenden schauen sich deshalb genauer an, wie besonders Kapitalismus und Technologie unsere Bilder vom Kommenden geprägt und verändert haben und diskutieren kritisch die Thesen des Verlusts einer positiven Beziehung zur Zukunft.
Ähnlichen Ideen geht Dr. Robert Schäfer im Proseminar «Ende der Utopie? Soziologische Erforschung gegenwärtiger Zukunftsvorstellungen» mit den Studierenden nach.
Auch in dieser Veranstaltung rückt die Frage in den Vordergrund, wieso unser Blick in die Zukunft zunehmend von Unsicherheit, Skepsis oder gar Angst begleitet wird. Grosse Utopien, Visionen und Hoffnungen scheinen in der Vergangenheit stehengeblieben zu sein.
Alles eine Frage der Perspektive
«Seit sechzig Jahren schon behaupten Soziolog*innen bis heute immer wieder, dass optimistische Entwürfe einer Zukunft an Kraft verlieren würden», erklärt Schäfer. «Statt Utopien würden in vielen Debatten die Angst vor dem, was kommt, dominieren.» Damit rücken Dystopien ins Zentrum. Diese erzählen nicht mehr vom Fortschritt, sondern malen ein apokalyptische Bild der Zukunft. Auch Nostalgie spielt hier eine Rolle. Wer behauptet, früher sei alles besser gewesen, so Schäfer, füttert oft eine pessimistische Grundhaltung, die neue Perspektiven verdunkelt.
Ganz ohne Hoffnung verbleiben die Teilnehmenden aber dann doch nicht. Die Gruppe diskutiert nämlich auch, ob der Blick nach vorne wirklich so düster ist, wie oft behauptet wird. Dabei geht es etwa um Ideen rund um Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Innovationen oder technologische Möglichkeiten. So zeigt das Proseminar, dass das Morgen nicht nur durch verloren gegangene Utopien definiert ist, sondern auch Raum für neue bietet.
Risiko mit Aussicht
Neuen Entwicklungen stellen sich besonders junge Generationen. Mit Mirela Ivanova gehen die Studierenden im Seminar «Youth and Future» der Frage nach, wie Jugend und Zukunft verknüpft sind. Im Zentrum steht die Frage, wie junge Menschen in Zeiten sozialer Unsicherheiten, ökonomischen Umbrüchen und ökologischen Krisen auf das Morgen blicken. «Die Anforderungen haben sich verändert», so Ivanova, «von jungen Menschen wird heute erwartet, ihren Lebensweg eigenständig zu gestalten und Risiken selbst abzuwägen.»
Diese Verantwortung erzeugt Druck, doch viele blicken dennoch vorsichtig optimistisch ihrer persönlichen Zukunft entgegen.
Gleichzeitig zeigt das Seminar, wie ungleich Zukunftsorientierungen verteilt sind. Unterschiede zeigen sich nach Klasse, Geschlecht und Herkunft. Ivanova erklärt: «Jugendliche aus der Arbeiterklasse haben oft das Gefühl, ‹pragmatisch› sein zu müssen und sich schnell festzulegen, während Jugendliche aus der Mittelschicht ihre persönliche Zukunft flexibler und offener denken – und so die heutigen, entstandardisierten Lebensverläufe besser navigieren können.»
Bei kollektiven Entwürfen überwiegt dagegen Skepsis. Viele Jugendliche erleben gesellschaftliche Prozesse als kaum beeinflussbar. Klima- und Umweltkrisen, geopolitische Spannungen und Digitalisierung verstärken diese Ansicht. Die Zukunft ist und bleibt also ungewiss.