Unisonar S7|EP4: Wie real ist eine Fotografie im KI-Zeitalter?
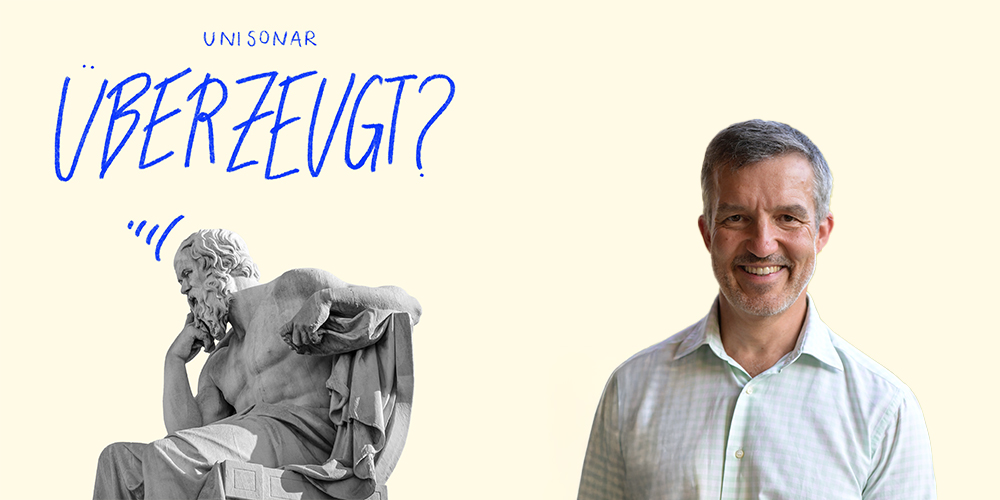
Wann zeigt ein Foto die Realität – und wann nicht? Peter Fornaro, Titularprofessor für Digital Humanities an der Universität Basel, spricht im Podcast über Bildmanipulation, künstliche Intelligenz und die Grenzen der fotografischen Wahrheit. Und wie KI-unterstützte Fotografien ein Gewinn für die Forschung werden können.
Peter Fornaro beginnt das Gespräch mit einem kritischen Blick auf die digitale Fotografie. Trotz der technischen Nähe zur Realität sei ein Foto letztlich nur ein Lichtbild, das durch Sensoren und Algorithmen stark verändert werden könne. «Es sind heute digitale Daten, die sich relativ leicht manipulieren lassen», erklärt Fornaro.
Besonders problematisch sei dabei der Begriff RAW, der eigentlich für unbearbeitete Sensordaten stehen sollte. In der Praxis würden jedoch selbst RAW-Dateien von Smartphones bereits durch Algorithmen nachgeschärft und verändert – ohne dass Nutzer dies abschalten könnten. «Das Schlimme ist, dass es gemacht wird – und das andere, was ich viel dramatischer finde: Ich kann das nicht abstellen.»
KI zwischen Hilfe und Täuschung
Trotz seiner Kritik an algorithmischer Nachbearbeitung räumt Fornaro auch die positiven Seiten der KI in der Fotografie ein. Künstliche Intelligenz könne helfen, technische Schwächen kleiner Smartphone-Kameras auszugleichen und Laien zu professionellen Bildern zu verhelfen.
Funktionen wie das künstliche Freistellen von Porträts oder das Fotografieren bei schwachem Licht seien beeindruckende technische Leistungen. Dennoch warnt er: «Ich finde diese Bildmanipulation viel krasser, wo wirklich Bildinhalt wesentlich verändert wird.» Solche Veränderungen seien in journalistischen oder forensischen Kontexten besonders problematisch, da Authentizität kaum noch überprüfbar sei.
Gefahr für Journalismus und Gesellschaft
Vor allem im Bereich der Pressefotografie sieht Fornaro ein hohes Risiko durch manipulierte oder KI-generierte Bilder. Zwar gebe es Initiativen wie die «Content Authenticity Coalition», die auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Bildentstehung setzen. Doch die Praxis sei oft eine andere.
«Manipulation ist relativ schwierig herauszufinden», warnt Fornaro und berichtet von Fällen, in denen Fotografen strikten Regeln unterliegen – wie etwa bei National Geographic – während gleichzeitig soziale Medien eine Flut an Bildern liefern, deren Herkunft und Echtheit kaum überprüft werden können. «Es ist auch wichtig, dass die Leute geschult werden und ein gewisses Misstrauen gegenüber digitalen Plattformen an den Tag legen.»
Technische Lösungen und fehlende Standards
Ein Lösungsansatz zur Sicherung der Bildauthentizität wäre laut Fornaro eine technische Signatur, die bei der Aufnahme erzeugt wird. Eine Art digitale Prüfsumme, die jede nachträgliche Veränderung sichtbar machen würde.
Die Umsetzung sei jedoch schwierig, da Kamerakomponenten meist aus dem Ausland kommen und grosse Hersteller wie Sony keinerlei Rechte an Ideen einräumen, die an sie herangetragen werden. «Technisch wäre das hochinteressant», sagt Fornaro. Er sieht aber derzeit kaum realistische Chancen auf Umsetzung. Dennoch glaubt er, dass die Industrie grundsätzlich ein Interesse an der Erhaltung der Bildauthentizität hat.
Kulturelles Erbe digital erfassen
Neben der Kritik an KI-basierten Bildverfälschungen betont Fornaro auch die konstruktiven Möglichkeiten digitaler Technologien, etwa in der Archäologie. Mit Hilfe KI-gestützter Verfahren könnten beschädigte Statuen rekonstruiert oder dreidimensionale Modelle komplexer Objekte erstellt werden.
Besonders faszinierend sei die Erfassung von Materialeigenschaften wie Glanz oder optischer Tiefe, etwa bei Haut oder Marmor. «Das sowohl zu messen wie auch korrekt wiederzugeben ist echt eine Herausforderung und fehlt bis heute noch.» Der Nutzen sei enorm, etwa für digitale Sammlungen, Lehre oder Forschung an schwer zugänglichen Originalen.
Medienkompetenz als Schlüssel zur Realität
Zum Schluss richtet Fornaro einen Appell an Bildungseinrichtungen. Digitale Medienkompetenz müsse bereits in der Primarschule vermittelt werden: Nicht nur die Nutzung digitaler Tools, sondern auch das kritische Hinterfragen der Funktionsweise.
«Der Konsum steht im Vordergrund von digitalen Inhalten, weniger das selber erzeugen und technisch hinterfragen.» Auch wenn KI-generierte Inhalte heute täuschend echt wirken, dürfe sich die Gesellschaft nicht von der Realität verabschieden. Im Gegenteil, sagt Fornaro: «Man sollte den Begriff der Realität viel stärker ins Zentrum stellen.»







