Rund 3900 Maturandinnen und Maturanden aus der ganzen Schweiz und dem grenznahen Ausland haben sich heute über das vielfältige Studienangebot an der Universität Basel informiert.

Ein speziell für Kinder entwickeltes Aufwärmprogramm reduziert Fussballverletzungen um rund 50 Prozent. Dies berichten Sportwissenschaftler der Universität Basel in der Fachzeitschrift «Sports Medicine». An der Studie nahmen 243 Teams mit insgesamt rund 3900 Kindern in vier europäischen Ländern teil.

Rund die Hälfte des Energieverbrauchs geht auf das Konto der Haushalte. Sie spielen deshalb eine zentrale Rolle, will man die Ziele der schweizerischen Energiestrategie erreichen. Ein White Paper des Forschungszentrums SCCER CREST macht fünf Empfehlungen für die Gestaltung von Massnahmen, die den Energieverbrauch der Schweizer Haushalte substanziell reduzieren können.

Leidet eine Zelle unter Zuckermangel, speichert sie bestimmte Boten-RNAs, um so ihr Leben zu verlängern. Wie eine Forschungsgruppe am Biozentrum der Universität Basel nun herausfand, entscheidet das Protein Puf5p bei Zuckermangel in der Zelle darüber, ob eine Boten-RNA aufbewahrt oder abgebaut wird.
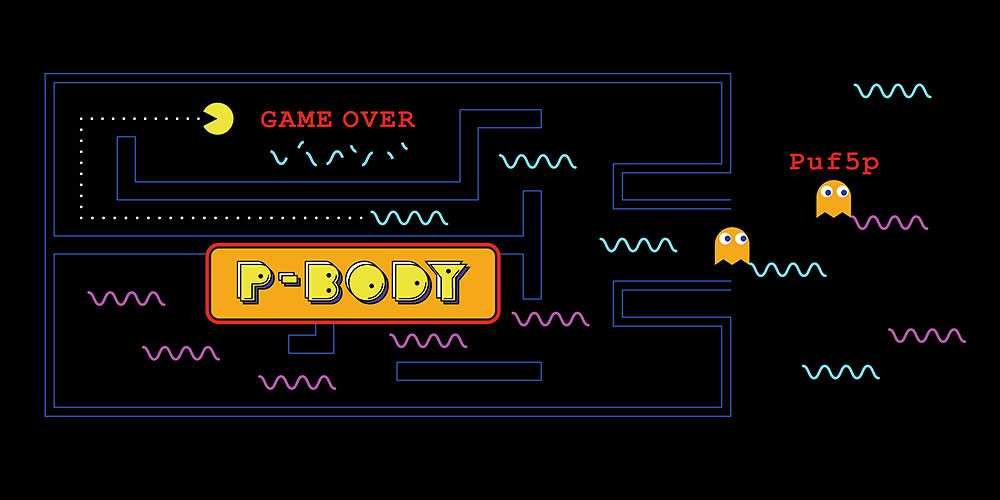
In der ersten Förderrunde der Ausschreibung «Seed Money» hat Eucor – The European Campus die Finanzierung von acht Projekten in Forschung und Lehre mit einer Gesamtsumme von 300'000 Euro bewilligt.
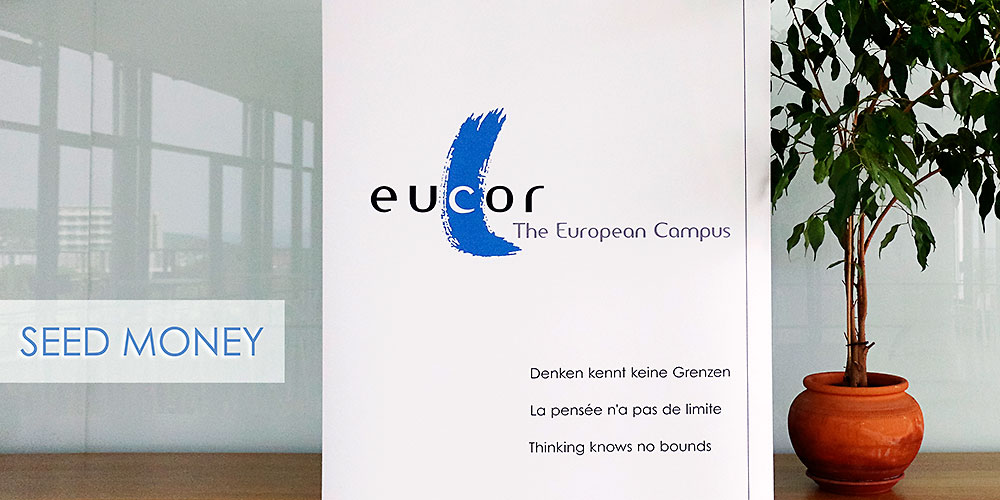
Eine Pionierin der frühen Naturwissenschaft, Mary Elizabeth Barber, wurde vor genau 200 Jahren geboren. Die Britin entwickelte in Südafrika eigenständige Ansätze, wurde aber als Frau kaum ernst genommen. Die Basler Historikerin Tanja Hammel auf den Spuren von Leben und Werk der vergessenen Forscherin.

Bei Jungen gehen kühle und emotionslose Persönlichkeitszüge mit strukturellen Veränderungen im Gehirn einher, nicht aber bei Mädchen.

