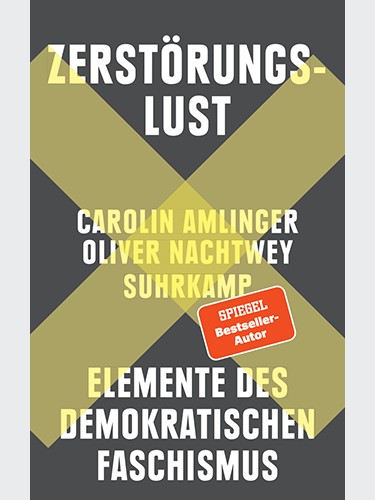«Wir brauchen wieder neue Mythen, die Lust auf Teilhabe machen.»
Warum sehnen sich immer mehr Menschen in westlichen Demokratien nach Zerstörung? Und weshalb stimmen sie für Parteien, die genau das versprechen? Die Literatursoziologin Dr. Carolin Amlinger erklärt die Ursachen des globalen Rechtsrucks und zeigt, warum auch die Schweiz nicht immun ist.
13. Oktober 2025 | Noëmi Kern
Frau Amlinger, Ihr neues Buch heisst «Zerstörungslust». Das klingt nicht gerade hoffnungsvoll. Was haben Sie untersucht?
Mein Co-Autor Oliver Nachtwey und ich wollten verstehen, warum in vielen westlichen Gesellschaften rechte Parteien im Aufschwung sind. Allein in der EU sind derzeit in sieben Staaten rechte Parteien an der Regierung beteiligt. Wir widmeten uns darum der Frage, was hinter der Krise etablierter Demokratien steht. Wie kann es dazu kommen, dass so viele Menschen, die demokratisch sozialisiert wurden und über grosse Freiheiten verfügen, ebendiese Freiheiten und mit ihnen die Prinzipien der demokratischen Mitbestimmung lustvoll ablehnen? Diesem Phänomen, zentrale Institutionen der liberalen Demokratie zerstören zu wollen, sind wir empirisch auf den Grund gegangen.
Wie sind Sie vorgegangen?
Zunächst haben wir in Deutschland eine Umfrage mit 2600 Teilnehmenden durchgeführt und dafür Aussagen verwendet wie «Ich möchte, dass unsere Gesellschaft in Schutt und Asche gelegt wird», «Es kann gewisse Gründe geben, dass gewalttätiges Verhalten gerechtfertigt ist» oder «Wenn ich an soziale oder politische Institutionen denke, dann kann ich gar nicht anders denken, als dass sie untergehen sollen». Die Befragten konnten diesen Aussagen auf einer Skala zustimmen oder sie ablehnen. Bei dieser Umfrage kam heraus, dass 12,5 Prozent der Befragten destruktiv sind, das heisst, mittlere oder hohe Zustimmungswerte hatten. Das klingt erst mal nicht nach viel, aber es ist immerhin mehr als jede zehnte Person. Diese Personen waren eher jung, eher männlich und in der politischen Selbstverortung eher rechts.
Was steht hinter dieser Destruktivität?
Wir wollten die emotionale Tiefengeschichte hinter diesen 12,5 Prozent besser verstehen. Denn Politik findet im gelebten Alltag statt. Darum haben wir ergänzend 41 Interviews geführt.
Wir erkundigten uns zunächst nach der politischen Meinungsbildung und dem Vertrauen in politische und gesellschaftliche Institutionen, aber ebenso nach ihrer sozialen Laufbahn, ihrer Biografie und ihrem Elternhaus.
Können Sie die Ergebnisse zusammenfassen?
Die Beweggründe und sozialen Ausgangsbedingungen für destruktive Einstellungen sind sehr unterschiedlich. Mit Blick auf die sozialen und biografischen Laufbahnen fällt auf, dass viele Personen gleich mehrere soziale Brüche oder private Schicksalsschläge erfahren haben. Dadurch wächst das Gefühl, dass die Gesellschaft ihre eigenen Versprechen nicht mehr einhalten kann, nämlich das Versprechen auf ein auskömmliches Leben, das durch soziale Aufstiegsmöglichkeiten zu erreichen ist. Das ist uns in unterschiedlichen Berufsklassen immer wieder begegnet.
Können Sie Beispiele geben?
Manche haben viel in die eigene Bildung investiert. Doch das Versprechen auf Aufstieg durch Bildung löste sich für sie nicht oder nur gebrochen ein. Manche Unternehmer und Selbstständige fühlten sich durch die wachsende Bürokratie zunehmend gegängelt und in ihrer wirtschaftlichen Produktivität eingeschränkt, beispielsweise durch Diversity-Programme oder Klimaschutzvorgaben. Viele haben auch darüber berichtet, dass die öffentliche Infrastruktur nicht mehr funktioniert, dass der Nahverkehr permanent Verspätung hat, dass die Parkanlagen nicht gepflegt werden und die Strassen voll Löcher sind… Viele haben im gleichen Atemzug von der sichtbaren Präsenz von «andersartigen Leben» im öffentlichen Raum berichtet, wie Geflüchtete oder nicht-binäre Personen.
Das alles zusammengenommen waren für die Interviewten Indizien, dass «im eigenen Leben alles schlechter» wird. Das Gefühl, dass um einen herum alles zugrunde geht, führt zu einer verallgemeinerten Wahrnehmung, dass die Gesellschaft sich zunehmend schliesst und nicht mehr für eine Vergrösserung der Chancen steht.
Und daran sind die «Andersartigen» schuld?
Nein, natürlich nicht real. Aber aus dem Gefühl gesellschaftlichen Niedergangs resultiert eine Form des Nullsummendenkens: die Gewinne der einen Gruppe bedeuten einen direkten Verlust für die andere Gruppe. Der gesellschaftliche Reichtum ist hier wie ein Kuchen, den man aufteilen kann. Je mehr Menschen mitessen wollen, desto weniger bleibt für mich übrig. Die Interviewten nannten immer wieder die wachsende Zahl an Migrantinnen und Migranten, die zunehmende Integration von sozialen Minderheiten, oder die Frauenerwerbstätigkeit, die von Männern als Bedrohung empfunden wird. Es wurde ein falscher Kausalzusammenhang hergestellt: die Verschlechterung meines Lebens geht mit der Verbesserung anderer Leben einher. Dieser gefühlten Wahrnehmung wollten wir auf den Grund gehen und die Menschen in ihren Lebenserzählungen ernst nehmen, um sie zu verstehen. Verstehen heisst aber nicht verzeihen. Wir wollten die Ratio im scheinbar Irrationalen offenlegen, um die Ursachen des derzeitigen Rechtsrucks in etablierten Demokratien analysieren zu können.
Wo liegen diese?
Viele liberale Regierungen haben in den letzten Jahren beispielsweise über Sachzwänge Politik gemacht: Es ist kein Geld da, also müssen die Kommunen sparen und können nicht mehr investieren in die Schulen, in die öffentlichen Schwimmbäder, in die Infrastruktur. Auf der anderen Seite war aber Geld da, um Banken zu retten, oder für die militärisch Aufrüstung. Das führt nicht unbedingt dazu, dass das Vertrauen in den Staat und seine Regierung gestärkt wird, im Gegenteil. Das Misstrauen gegenüber dem Staat hat enorm zugenommen und ist eben auch ein Resultat der Politik.
Und die Hoffnung der Menschen ist, dass neue Kräfte das ändern können?
In vielen Interviews war die Rede von Minderheiten und Mehrheiten. Es ist ein Gefühl, dass die Mehrheit nicht gehört wird und dass man unter einer Tyrannei der Minderheit leidet. Die Befragten hoffen, dass die rechtsextremen Kräfte eine Politik unter dem Primat der Mehrheit machen.
Wir bringen Demokratie meist in Verbindung mit Wahldemokratie und einem Parlament. Die heutige Rechte versteht unter Demokratie eher eine Abstammungsgemeinschaft, in der alle anderen entfernt oder beherrscht werden. Man sieht sich als Vertreter des «Volkswillens». Um diesen durchzusetzen, kann man auch zu autoritären Mitteln greifen. Der historische wie der gegenwärtige Faschismus gehen davon aus, dass die Wahl des Parlaments, das ewige Diskutieren, die Konsenssuche nicht dazu geeignet sind, moderne soziale Probleme zu lösen.
Sie schreiben auch von der Polykrise: Klimawandel, Digitalisierung, Migration, verschiedene Geschlechter… Das sind viele komplexe Themen. Sehnen sich die Menschen einfach nach Orientierung?
Ich würde gar nicht von Orientierung sprechen, es ist eher ein Wunsch, Souveränität zu erhalten gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen, denen man sich ausgeliefert fühlt. Das Gefühl, blockiert zu sein, nicht voranzukommen, individuell wie gesellschaftlich, führt dazu, einfach alle Hindernisse beiseite räumen zu wollen, die einem im Weg stehen. Das ist der sozioemotionale Kern der Zerstörungslust, die die Demokratie von innen heraus entliberalisieren will. In diesem Sinn stiftet Destruktivität Orientierung, weil man «aufräumt» oder eben der «starke Mann» es stellvertretend für einen tut. Drei Viertel der Wählerinnen und Wähler der Republikaner befürworten in den USA etwa diktatorische Massnahmen, um den Staat wieder «in die Spur» zu bringen.
Sie fokussieren im Buch auf Deutschland und die USA. Wie schätzen Sie die Situation in der Schweiz ein?
In der Schweiz hatte die SVP im Wahlbarometer zuletzt 30 Prozent, ein noch nie erreichter Höchstwert. Die SVP hat zwar die rechten Kräfte in sich absorbiert, und es bildete sich dadurch keine neue rechtsextreme Partei, dadurch ist sie aber selbst rechter geworden. Die Schweiz ist in dieser Hinsicht also kein Sonderfall unter den westlichen Demokratien. Gleichzeitig gibt es aber grosse Unterschiede. Die Befragten Personen nahmen die Schweiz als ein Land wahr, in der die «Welt noch in Ordnung» ist. Dies liegt nicht daran, dass es hier weniger Ungleichheiten geben würde. Die Schweiz ist, wenn man so möchte, eine stabile ungleiche Gesellschaft, die aber über die direkte Demokratie für die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl unvermittelter Teilhabe vermittelt.
Könnte sich das politische Klima nicht auch hier wandeln?
Es ist angesichts der hohen Umfragewerte für die SVP nicht komplett ausgeschlossen. Darum ist es wichtig, dass es nicht zu einer Normalisierung einer rechten Weltwahrnehmung kommt, zum Beispiel dem Gefühl, von Andersartigem überrannt zu werden.
Mit der «Grenzschutz-Initiative» bewirtschaftet die SVP stark dieses Ressentiment. Das Thema haben in der Schweiz aber auch Teile der konservativen oder bürgerlichen Mitte übernommen. In den Nachbarländern hat man gesehen, dass die konservativen Parteien keine Stimmen von der Rechten zurückgewinnen, wenn sie auf die Themen der Rechten setzen, sondern dass es im Gegenteil die Rechte am Ende stärkt, weil deren Positionen so eine Legitimität erhalten.
Wie lässt sich mit dieser Zerstörungslust konstruktiv umgehen?
Der Faschismus lebt nicht von Argumenten, sondern von Mythen. Wir brauchen wieder neue Mythen, die Lust auf Teilhabe machen, auch weil sich die Mythen des Liberalismus erschöpft haben. Fortschritt und Aufstieg greifen mit ihrer Idee des expansiven Wachstums angesichts des Klimawandels nicht mehr. Nur: Was setzen wir dem entgegen, auch als eine neue Vision des Zusammenlebens? Darüber muss man, glaube ich, anfangen nachzudenken.
Wo sehen Sie Grund zur Hoffnung?
In unserer Erhebung waren über 60 Prozent nicht destruktiv. Es gibt also nach wie vor antifaschistische Mehrheiten. Das muss man betonen und dort ansetzen: Die Mehrheit der Bevölkerung will in einer demokratischen Gesellschaft leben.
Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey erhalten den Geschwister-Scholl-Preis 2025
Die Literaturwissenschaftlerin Dr. Carolin Amlinger und der Soziologe Prof. Dr. Oliver Nachtwey von der Universität Basel werden mit dem Geschwister-Scholl-Preis 2025 ausgezeichnet. Die Jury würdigt ihr gemeinsam verfasstes Buch «Zerstörungslust. Elemente des demokratischen Faschismus» als herausragenden Beitrag zur Analyse aktueller gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen.