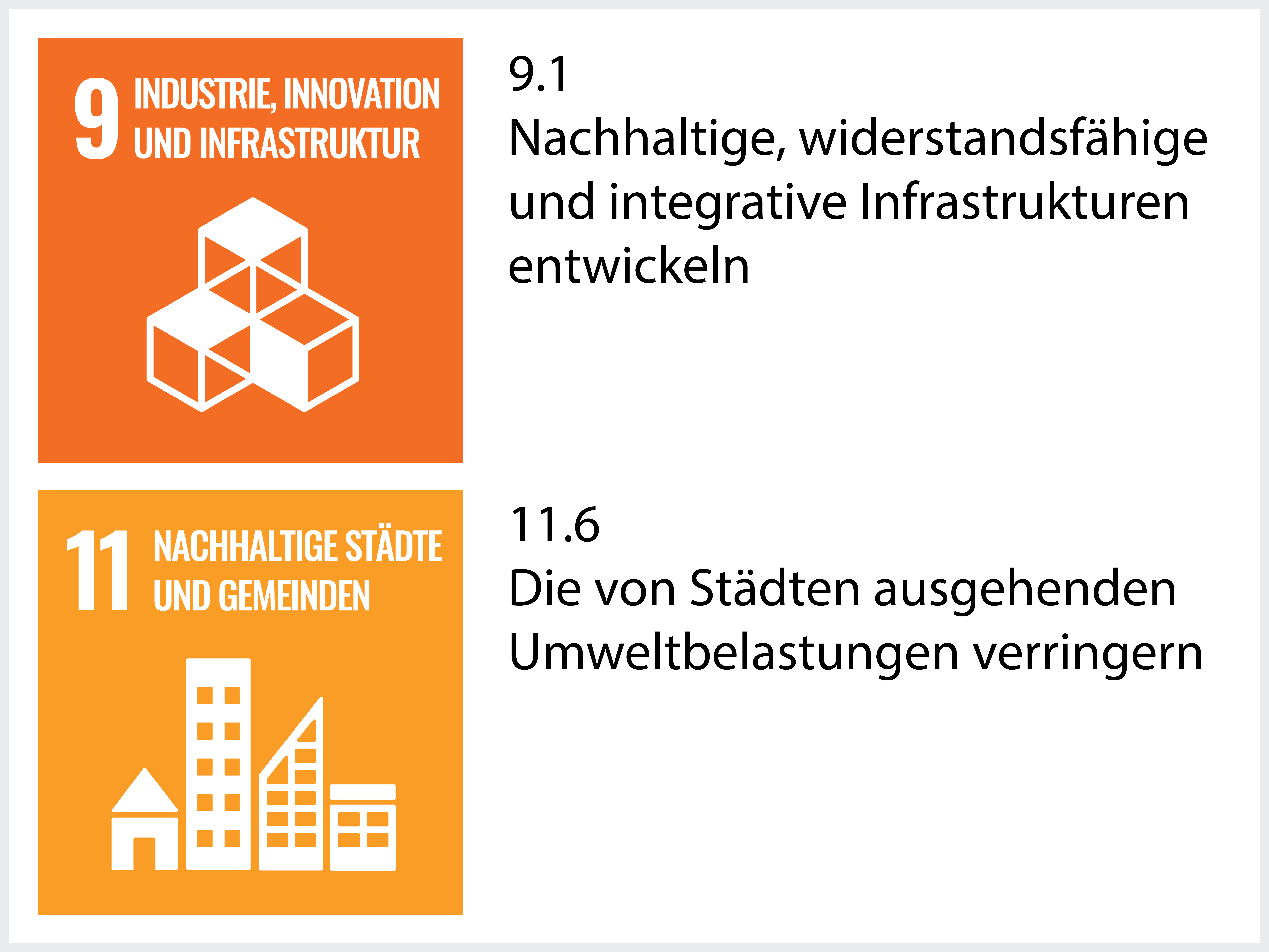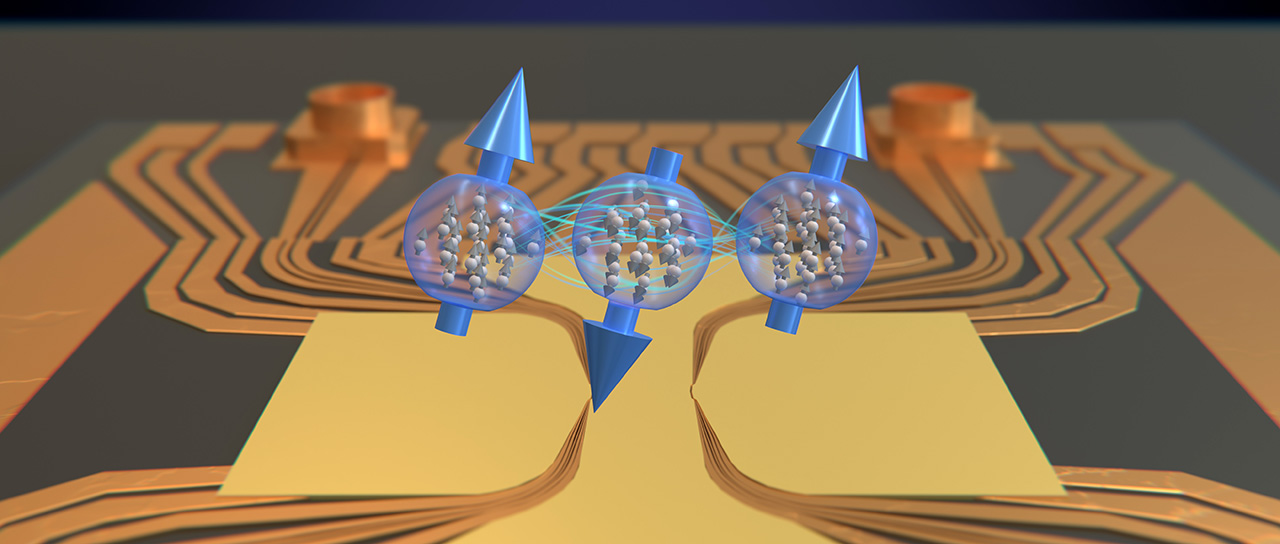Immobilien

Seit 2023 werden beim Neubau des Departements Biomedizin im St. Johanns-Quartier Akzente für nachhaltiges Bauen gesetzt, um Ressourcen während der Bautätigkeiten und im späteren Betrieb einzusparen. Die über den Lebenszyklus von Baustoffen anfallende «graue Energie» in universitären Gebäuden verursacht hohe Treibhausgasemissionen und wurde daher in der 2024 veröffentlichten Klimastrategie in einem gesonderten Bereich mit Massnahmen adressiert. Zukunftsweisende Raumnutzungen mit flexiblen «Multispace»-Ansätzen, wie sie im Department Biomedical Engineering seit 2023 umgesetzt werden, können bei richtiger Planung Flächen und Material einsparen.
Nachhaltigkeit beim Neubau des Departements Biomedizin
Im September 2023 haben die Bauarbeiten für den Neubau des Departements Biomedizin auf dem Life-Science-Campus der Universität Basel im St. Johanns-Quartier begonnen. Das Laborgebäude soll bis 2031 bezugsfertig sein und wird Platz für 900 Mitarbeitende und 200 Studierende bieten. Der Bau wird in Anlehnung an den Minergie-Standard1 gebaut und berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte in verschiedenen Bereichen. So kann durch den Einsatz intelligenter, elektrochromer Gläser2 in der Glasfassade die Verdunklung der Fenster bei Sonneneinstrahlung gewährleistet werden, so dass eine zweite, materialintensive Fassadenschicht inklusive Storeninstallation eingespart werden konnte. Zudem wird auf den Einbau einer zentralen Heisswasseranlage verzichtet. Stattdessen wird im späteren Betrieb ein Durchlauferhitzer nur dann Wasser erwärmen, wenn es gerade benötigt wird. So kann einerseits Material für die Verrohrung gespart und andererseits der Energieverbrauch im Betrieb reduziert werden. Am Ende der Bauphase ist auf dem Dach des Departements neben der Installation einer Photovoltaikanlage auch eine umfängliche Dachbegrünung mit regionalen Pflanzen, Böschung und Totholzhabitaten geplant.
Graue Energie - Hohe Emissionen über den Lebenszyklus
Für den Forschungs- und Lehrbetrieb der Universität sind Neu- und Umbauten unerlässlich. Gleichzeitig sind sie aufgrund des hohen Materialeinsatzes immer auch ressourcenintensiv. Diese in Gebäuden enthaltene «graue Energie» bilanziert die Emissionen von Neu- und Umbauten über den Lebenszyklus der verwendeten Baustoffe bis zur Entsorgung nach Nutzungsende über 30-60 Jahre.3 Für einen Neubau wie das Laborgebäude des Departements Biomedizin mit 35‘000 m2 Geschossfläche fallen dabei Treibhausgasemissionen in Höhe von ca. 22’000 Tonnen CO2-eq an, die über 60 Jahre angerechnet werden.4 Auf ein Jahr gerechnet, verursacht der Neubau damit fast dreimal so viele Treibhausgasemissionen wie alle bisher quantifizierten Emissionsbereiche der Universität zusammen.5 Aufgrund des hohen Impacts wurde der Bereich «Graue Energie Gebäude» in der Klimastrategie 2024-30 der Universität aufgenommen und Massnahmen definiert, um den Anstieg der Treibhausgasemissionen durch Neu- und Umbauten abzuschwächen. Ein Ansatz ist die Erhöhung der Flächeneffizienz in Bürogebäuden, z.B. über den Einsatz von Desk-Sharing in sogenannten «Multispace»-Modellen.
Multispace-Räume am Departement for Biomedical Engineering
Im Dezember 2022 bezog das Department of Biomedical Engineering (DBE) seine neuen Räumlichkeiten im Innovationsquartier BaseLink in Allschwil. Die Räume für das DBE wurden dabei bewusst mit dem «Multispace»-Ansatz geplant und eingerichtet, um eine hohe Flexibilität bei der Raumgestaltung zu erreichen, z.B. für wechselnde Forschungskooperationen. Statt vieler Einzelbüros und personalisierten Arbeitsplätze wird per «Desk-Sharing» im offenen Raum zusammengearbeitet. Eine zentrale Lounge mit einer Kaffeemaschine lädt zum Austausch während Pausen und Teamevents ein. Aus Sicht der Ressourcennutzung sind Multispace-Modelle interessant, da je nach Umsetzung weniger Fläche und weniger Möbel zum Einsatz kommen müssen. Auch ein Personalzuwachs wie beim DBE konnte so durch die höhere räumliche Flexibilität ohne Flächenzuwachs realisiert werden.6
[1] Eine Zertifizierung mit dem Minergie-Standard ist bei Forschungsgebäuden aufgrund der hohen technischen Anforderungen und der komplexen Nutzungsprofile nicht sinnvoll (z.B. bezüglich der Vorgaben zur Dämmung von Wänden, wenn in den Räumlichkeiten viel Wärme durch Forschungstätigkeiten produziert wird).
[2] Intelligente, elektrochrome Verglasungen können ihre Lichtdurchlässigkeit durch das Anlegen einer elektrischen Spannung (Elektrochromie) verändern und so z.B. einfallendes Sonnenlicht verdunkeln.
[3] Die Anrechnungsdauer variiert je nach eingesetztem Material.
[4] Die Berechnung der Treibhausgasbilanz beruht nicht auf einer zugrundeliegenden Ökobilanz, sondern wird anhand der Geschossfläche und einem Emissionsfaktor pro m2 berechnet. Anrechnungszeit über 30-60 Jahre gemäss SIA-Standard (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein).
[5] Die Treibhausgasbilanz der Universität Basel für 2024 liegt bei 7'725 tCO2-eq.
[6] Vor der Einführung von Multispace-Modellen ist ein sorgfältiges Change Management nötig, um die Mitarbeitenden für die neuen Bedingungen zu sensibilisieren. Auch neue Mitarbeitende müssen entsprechend begleitet werden.