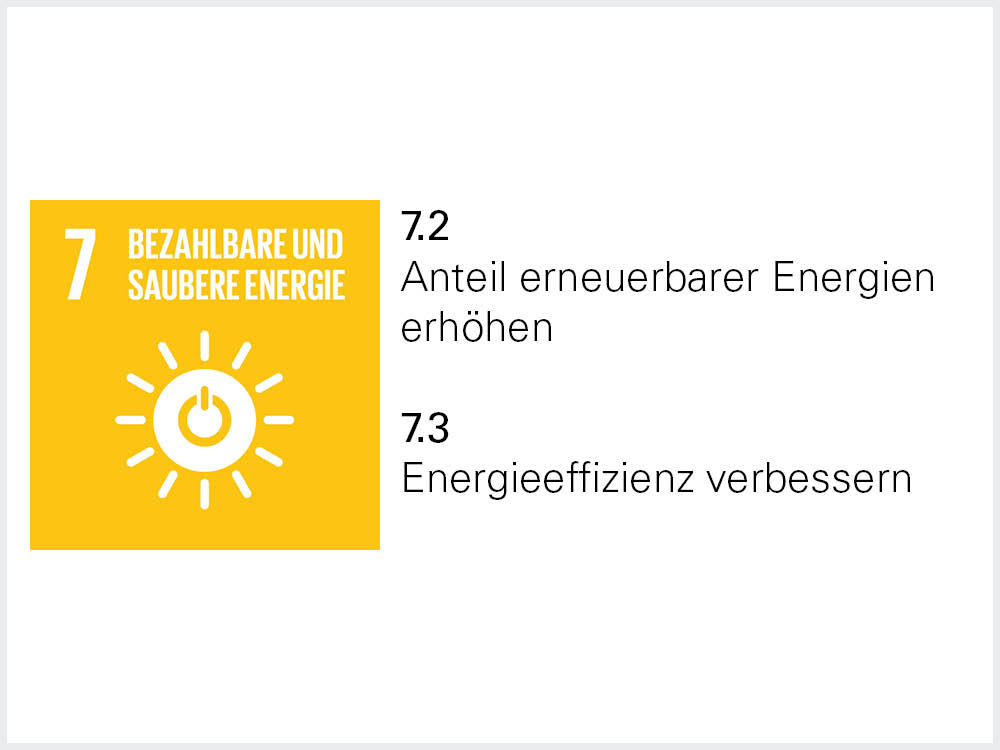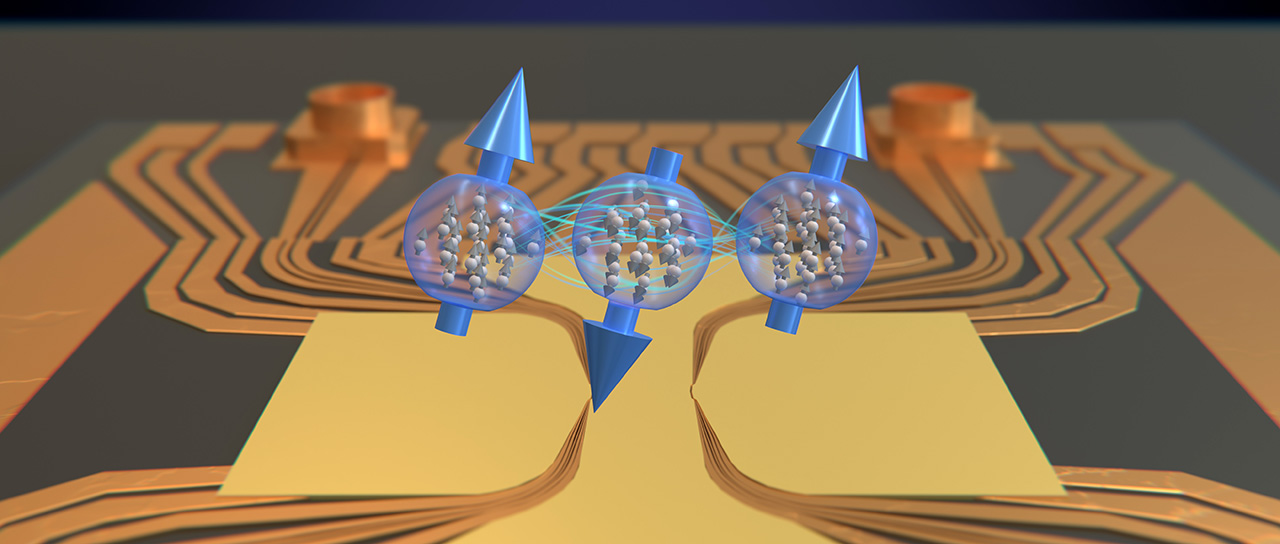Energie

Im Jahr 2023 verzeichnete die Universität Basel einen Rückgang des Strom- und Wärmeverbrauchs, 2024 stiegen diese Werte wieder an. Der Fernkälteverbrauch ist in beiden Jahren leicht gesunken. Ein wichtiger Fortschritt in der Energieversorgung wurde mit Inbetriebnahme der neuen Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des Departements für Sport Bewegung und Gesundheit erzielt, so dass die eigene Solarstromproduktion zukünftig erheblich gesteigert werden kann. Neben der fortlaufenden Identifikation und Umsetzung von Energieeffizienzmassnahmen durch die Direktion Infrastruktur & Betrieb trugen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Projekten wie der «Electricity Saving Challenge» und der «Green Lab Initiative » zu bewussten Energieeinsparungen im Forschungsalltag bei.
Energieverbrauch
Die Universität Basel deckt ihren Energiebedarf hauptsächlich durch Elektrizität (rund 58% des Gesamtverbrauchs im Jahr 2024), Fernwärme (ca. 40%) und Fernkälte (ca. 2%). Der Gesamtenergieverbrauch stieg von 59,3 GWh im Jahr 2023 auf 63,8 GWh im Jahr 2024 an, was insbesondere auf einen höheren Verbrauch im Life Science Campus zurückzuführen ist.1
Der Stromverbrauch (inkl. Strom für die Kälteerzeugung durch Kältemaschinen) zeigte über die Jahre einen kontinuierlichen Anstieg, sowohl in den Gesamtwerten als auch pro Kopf.2 Bezogen auf die Hauptnutzfläche blieb der Verbrauch jedoch weitgehend konstant. Der Wärmeverbrauch zeigte in den letzten Jahren gewisse Schwankungen, die unter anderem durch Witterungseinflüsse verursacht werden können3. Im Jahr 2021 wurde aufgrund der parallelen Nutzung des alten und neuen Biozentrums während der Umzugsphase deutlich mehr Energie verbraucht. Die Nutzung von Fernkälte durch den Kälteverbund Petersplatz ist seit der Umstellung 2021 auf einem konstanten Niveau.
Energiebeschaffung und -produktion: Mehr Sonnenenergie
Im Herbst 2024 konnte die Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des Departements für Sport, Bewegung und Gesundheit (DSBG) in Münchenstein ihren Betrieb aufnehmen. Mit einer Grösse von ca. 1'400 m2 gehört sie zu den grösseren PV-Anlagen in Basel und kann zukünftig durchschnittlich ca. 302'000 kWh Strom pro Jahr produzieren. Rund 30% des Stroms werden direkt in den Sporthallen, Seminarräumen und Büros verbraucht, der Rest wird in das Stromnetz eingespeist, auf das auch das DSBG in der Nacht zurückgreift. Die bereits länger bestehende Photovoltaikanlage auf dem Pharmazentrum lieferte in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt etwa 60'000 kWh Strom. Auch 2023 und 2024 bezog die Universität Basel den grössten Teil ihrer Energie aus erneuerbaren Quellen.
Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs
In den vergangenen zwei Jahren wurden verschiedene Massnahmen umgesetzt, um den Energieverbrauch zu optimieren und einen nachhaltigen Universitätsbetrieb zu fördern: Gebäudesanierungen, Optimierungen in der Gebäudetechnik, Beleuchtung und Kühlung, Einsatz von Energiemanagementsystemen und Nutzersensibilisierung. Um den Energieverbrauch gezielt zu überwachen und weitere Einsparpotenziale zu identifizieren, wurden verschiedene Optionen zur Weiterentwicklung des Monitoringsystems getestet, die in den kommenden Jahren implementiert werden sollen. Um das Bewusstsein der Universitätsangehörigen für den Energieverbrauch zu sensibilisieren, wurden Initiativen wie die "Electricity Saving Challenge" oder die "Green Lab Initiative" ins Leben gerufen. Diese adressieren insbesondere das Nutzerverhalten der Forschenden im Laborbereich. Zusätzlich zu den eigenen Reduktionszielen der Klimastrategie ist die Universität Basel als Grossverbraucher verpflichtet, in bestimmten Immobilien eine jährliche Energieeffizienzsteigerung von 2% über zehn Jahre zu erreichen. 2024 wurden spezifische Massnahmen für sieben energieintensive Gebäude definiert, die in den kommenden Jahren umgesetzt und kontinuierlich evaluiert werden.4
Weitere Massnahmen und Projekte aus dem Bereich Energie werden in der folgenden Bildergalerie vorgestellt:
Effiziente Nutzung von Rechenressourcen
In den letzten Jahren hat der zunehmende Einsatz von Computermethoden in der Forschung, wie z. B. künstliche Intelligenz durch «Large Language Models» auch in den Sozial- und Geisteswissenschaften, zu einer steigenden Nachfrage nach energieintensiven Rechenressourcen im «Center for Scientific Computing» (sciCORE) geführt. Eine effiziente Nutzung dieser Ressourcen ist von entscheidender Bedeutung, da ineffiziente Methoden, schlecht organisierte Workflows und ungeeignete Hardwarezuweisung den Energieverbrauch erheblich erhöhen können. Als Kompetenzzentrum für wissenschaftliches Rechnen stellt sciCORE gemeinsam mit dem Center for Data Analytics (CeDA) Infrastruktur, Training und Workflow-Optimierung bereit, um die Effizienz der Forschung zu steigern.
Zur Sensibilisierung analysiert sciCORE die Recheneffizienz und integriert diese Daten in monatliche Berichte für Forschungsteams. Damit soll bei den Forschenden eine Optimierung der sciCORE-Nutzung erreicht werden, um wiederum die Kosten und den ökologischen Fussabdruck zu senken. Ergänzend ermöglicht die Zentralisierung des Hardware-Managements bei sciCORE den Abbau ineffizienter Systeme. Durch diese Massnahmen trägt sciCORE dazu bei, eine nachhaltige Nutzung der Rechenressourcen zu fördern.
[1] Der höhere Energieverbrauch auf dem Life Science Campus ist insbesondere auf die Verbräuche des Biozentrums zurückzuführen. Dieses erreichte im Jahr 2024 erstmals seine vollständige Auslastung im Normalbetrieb, unter anderem mit dem Ausbau und Bezug aller Forschungsquadranten sowie dem Betrieb der Fischstation.
[2] Die Ursachen für den Anstieg des Stromverbrauchs sind nicht im Detail bekannt. Mögliche Erklärungen könnten die zunehmende Digitalisierung, der vermehrte Einsatz von technischen Geräten sowie energieintensive Forschungsaktivitäten sein.
[3] Auch andere Faktoren wie veränderte Raumnutzung, Umzüge, zunehmende Digitalisierung und verändertes Nutzerverhalten können eine Rolle spielen.
[4] Die Massnahmen wurden den Eigentumsverhältnissen entsprechend mit den zuständigen Vermietern und dem Kanton Basel-Stadt definiert.