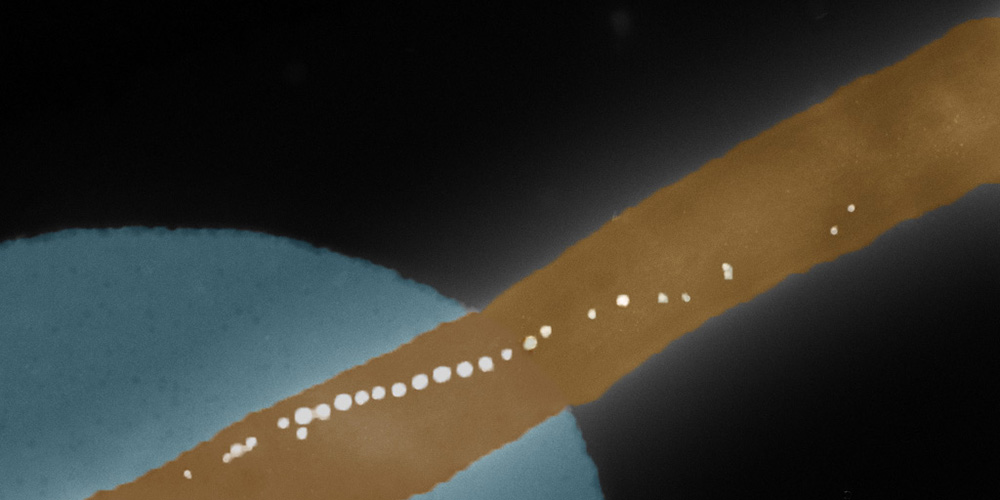Hass im Netz drängt Frauen aus der Politik
Sexistische Anfeindungen auf Online-Plattformen entmutigen junge Frauen, sich politisch zu engagieren. Das zeigt eine neue Studie der Universität Basel. Die Konsequenzen tragen nicht nur die direkt Betroffenen, auch die Demokratie nimmt Schaden.
25. November 2025
Beleidigungen, Drohungen und Hasskommentare im Internet betreffen viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen – auch Politikerinnen und Politiker. Forschende der Politikwissenschaft an der Universität Basel haben untersucht, wie häufig politisch aktive junge Frauen und Männer in der Schweiz auf Social-Media-Plattformen mit Anfeindungen konfrontiert sind und wie sich diese Erfahrungen auf ihre politischen Ambitionen auswirken. Die Studie ist im «Journal of Women, Politics & Policy» erschienen.
Hasskommentare werden zur Karrierehürde
Die Forschenden befragten Mitglieder aller grossen Schweizer Jungparteien – also Personen, die am Anfang einer möglichen politischen Laufbahn stehen – zu ihren Erfahrungen mit Online-Angriffen. Zwar berichten Männer und Frauen ähnlich häufig von Anfeindungen, die Inhalte unterscheiden sich aber deutlich. So sind Frauen wesentlich häufiger Ziel sexistischer oder sexualisierter Kommentare. «Zum Beispiel wird ihre Kompetenz grundsätzlich aufgrund ihres Geschlechts infrage gestellt. Bei Männern ist das nicht der Fall», sagt Dr. Daniel Höhmann, Erstautor der Studie.
Das hat Folgen: Frauen geben deutlich häufiger an, dass persönliche Erfahrungen mit Online-Angriffen ihre politische Arbeit behindern oder sie sogar dazu bewegen, sich aus der Politik zurückzuziehen. «Sie werden durch die Anfeindungen entmutigt, noch bevor sie überhaupt die Chance haben, für ein Amt zu kandidieren», so Höhmann.
Selbstzensur mit gesellschaftlichen Folgen
Mit ihrer Studie liefern die Forschenden neue empirische Evidenz zu einem wachsenden Problem, das in vielen Demokratien zu beobachten ist: Online-Angriffe gegen Frauen in der Politik sind keine Ausnahmeerscheinung, sondern Ausdruck struktureller Ungleichheit. Sie finden oft dort statt, wo politische Karrieren erst entstehen – im digitalen Raum.
Dass gerade junge Frauen besonders anfällig sind, liegt laut den Forschenden daran, dass sie sich noch in einer Phase befinden, in der politische Ambitionen und Identität erst gefestigt werden. Erleben sie in dieser Zeit Anfeindungen, steigt das Risiko, dass sie sich dauerhaft von der Politik abwenden. «Das bedeutet ein ernstzunehmendes Demokratiedefizit. Online-Hass ist deshalb nicht nur ein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem», gibt Daniel Höhmann zu bedenken.
Neben den direkten Folgen des Rückzugs beobachten die Forschenden eine subtile, aber folgenreiche Anpassung des Verhaltens junger Frauen: Viele geben an, auf Social Media vorsichtiger zu werden, Beiträge länger abzuwägen oder ganz auf politische Äusserungen zu verzichten. «Wenn junge Frauen erleben, dass politische Beteiligung mit Anfeindungen und Sexismus verbunden ist, und sich zurückziehen, verlieren Demokratien wichtige Stimmen und Talente. Die Vielfalt des politischen Diskurses leidet», so Höhmann.
Mehr Schutz und eine klare Haltung
In der Umfrage wünschten sich insbesondere weibliche Parteimitglieder mehr rechtliche Beratung, Schulungen zu digitaler Sicherheit und einen offenen Erfahrungsaustausch über den Umgang mit Online-Hass. Die Forschenden sehen die Parteien in der Pflicht und empfehlen, konkrete Anlaufstellen, juristische Unterstützung und eine klare Haltung gegen Anfeindungen im Netz zu etablieren. «Sie müssen lernen, ihre Nachwuchspolitikerinnen nicht allein zu lassen. Sie sollten die jungen Frauen besser schützen und sie begleiten, wenn sie Angriffe erleben», sagt Höhmann.
«Es ist eine wichtige Voraussetzung für die Gleichberechtigung in der Politik und eine paritätische Repräsentation», betont der Politikwissenschaftler. Anders gesagt: Die besten Frauenförderprogramme der Parteien nützen nichts, wenn sich junge Frauen durch Hasskommentare entmutigt fühlen und sich zurückziehen. Es ist daher entscheidend, Gegenstrategien zu entwickeln, um politische Teilhabe für alle zu sichern – auch online.
Originalpublikation
Daniel Höhmann, Tomoko Latteier und Stefanie Bailer
An Early Leak in the Pipeline – Online Abuse as a Barrier for Young Women’s Political Engagement
Journal of Women, Politics & Policy (2025), doi: 10.1080/1554477X.2025.2552573
Weitere Auskünfte
Dr. Daniel Höhmann, Universität Basel, Fachbereich Politikwissenschaft, Tel. +41 61 207 13 82; E-Mail: daniel.hoehmann@unibas.ch