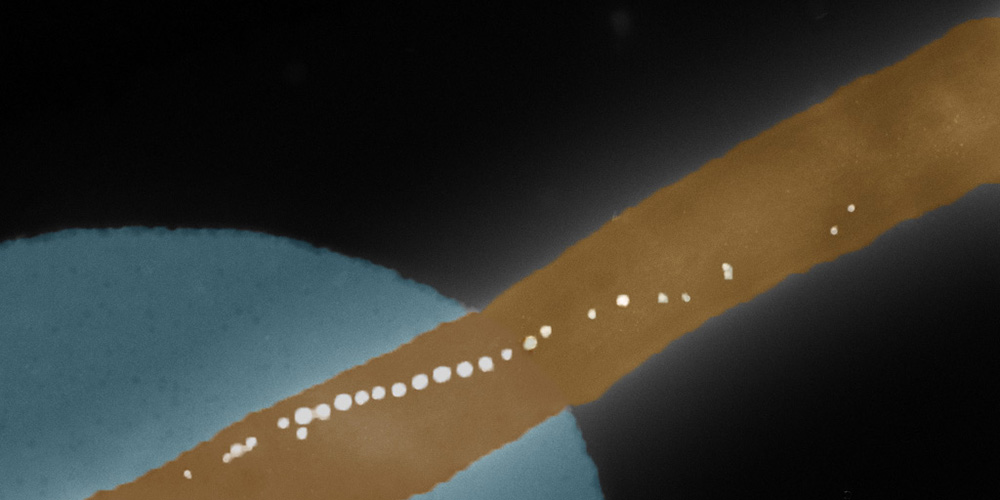Im Fokus: Linus Hany strukturiert Daten und plädiert für Ehrlichkeit im Umgang damit
In der Forschung befasst sich Linus Hany mit Statistiken, im Ehrenamt engagiert er sich für Menschen, die im System drohen vergessen zu gehen. An beiden Stellen will er keine vorschnellen Urteile fällen.
24. Juli 2025 | Noëmi Kern
Logik und exaktes Denken lagen Linus Hany schon immer. Als Spross einer Arbeiterfamilie absolvierte er zunächst eine Lehre als Elektroniker, merkte aber bald: «Das bin nicht ich.» Er interessierte sich mehr für Menschen und Politik als für technische Geräte. Er machte also die Berufsmatura und nahm mit 23 Jahren sein Studium an der Universität Zürich in Angriff.
Dort besuchte er Vorlesungen in verschiedenen Bereichen wie Ethnologie und Geschichte. «Das war mir dann wiederum zu wenig exakt und technisch», erzählt er. Also entschied er sich für das Psychologie-Studium, wo ihm die Kombination aus geisteswissenschaftlichen Themen und naturwissenschaftlichen Methoden zusagte. Im Nebenfach belegte er Philosophie. «Das interessierte mich zwar sehr, aber als Hauptfach war es mir zu abstrakt.»
Fehlschlüsse vorbeugen
Sein Interesse für die Grundlagen wissenschaftlicher Erkenntnis kam ihm im Psychologie-Studium sehr entgegen: Bereits im Bachelorstudium war Linus Hany fasziniert an Statistik. Es macht ihm Spass, aus Daten etwas herauszufinden. «Der Forschungsprozess ist aber komplex, es gibt nicht die eine Methode für alles. Entscheidend ist, wann und wieso ich welche Methode auf welche Daten anwende», sagt der 30-Jährige.
Mit seiner Forschung will Linus Hany neue, geeignete Methoden entwickeln und anwenden sowie bestehende besser verstehen, um Fehlschlüsse zu vermeiden. Gerade in unserer datengetriebenen Welt sei das wichtig. «Mit Machine Learning lässt sich vermeintlich alles lösen. Doch das Verständnis dafür, wie und wann eine neue Methode tatsächlich funktioniert, fehlt häufig noch.»
Ohne Kontext am Ziel vorbei
In der Psychologie ist das besonders relevant, da hier mit Daten gearbeitet wird, die von Menschen stammen. Solche Daten sind meist komplex, verschachtelt und stark vom Kontext geprägt. Daher ist es wichtig, im Umgang damit die richtige Methode anzuwenden.
«Unsere Forschung zeigt etwa, dass gewisse Machine Learning-Methoden die Bedeutung sogenannter Kontextdaten verzerren», erläutert Hany. Fehlender Kontext kann zu Falschinterpretationen führen, etwa bei Leistungsdaten: Kinder mit schlechten Schulnoten sind möglicherweise nicht faul oder weniger intelligent, sondern sie haben vielleicht zu Hause keinen ruhigen Arbeitsort. Lässt man solche Faktoren ausser Acht, drohen falsche Schlussfolgerungen – mit der Folge, dass zum Beispiel bildungspolitische Massnahmen getroffen werden, die am eigentlichen Problem vorbeizielen.
Besonders heikel werden solche methodisch bedingten Verzerrungen, wenn sie in psychologische Theorien, Anwendungen und zukünftige Forschung einfliessen. Denn die Psychologie will Phänomene nicht nur vorhersagen, sondern auch verstehen.
Ethische Grundsätze im Umgang mit Daten
Die Forschungswelt bezeichnet Hany als System, in dem es nicht allein darum gehe, Wissen zu generieren. «Als Forscherin oder Forscher muss man Abhängigkeitsverhältnisse in der Gesellschaft erkennen. Dazu gehört die ethische Pflicht, sich nicht losgelöst von allem anderen zu begreifen», betont er, denn: «Wer die Daten- und Deutungshoheit hat, trägt eine immense Verantwortung.» Ehrlichkeit ist ihm wichtig und er plädiert für den Mut, auch zu sagen, was man nicht weiss. «Ich bin mir nicht ganz sicher» lese man eigentlich nie in einem wissenschaftlichen Text.
An die Universität Basel kam Linus Hany wegen Mirka Henninger, die seine Doktorarbeit betreut. Er kennt die Psychologie-Professorin für Statistics & Data Science aus seiner Studienzeit an der Universität Zürich. «Ich finde ihre Forschung sehr spannend. Hätte sich diese Gelegenheit nicht geboten, hätte ich kaum eine Dissertation in Angriff genommen», ist Hany überzeugt.
Sportlicher Einsatz für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen
Linus Hanys zweite Leidenschaft gilt dem Sport, den er mit sozialem Engagement verbindet. Er ist Präsident eines Behindertensportvereins und gestaltet als Sportleiter Trainings und Angebote für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. «In der Schweiz ist das Angebot für Menschen mit einer geistigen oder einer körperlichen Beeinträchtigung im Sport gross. Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung fallen hingegen oft durch die Maschen», sagt er. Diese Menschen zu begleiten und damit dazu beizutragen, diese Lücke zu schliessen, ist ihm ein grosses Anliegen. Dazu gekommen ist er über den Sport: «Ich wurde angefragt eine Sportgruppe zu leiten», sagt er. «Da hat es mir den Ärmel reingenommen.»
Inzwischen arbeitet Hany auch in Forschungsprojekten in diesem Bereich; eines davon ist «Inklusion im Sport: Alkoholprävention mit Menschen mit Beeinträchtigungen» (ISAMB), das über Gefahren und Risiken von Alkoholkonsum aufklären will, ein anderes untersucht das Sportverhalten von Menschen mit einer Querschnittlähmung. «Mit diesen Tätigkeiten kann ich den Wert der Forschung mit den humanistischen Werten verbinden, die mich schon im Philosophiestudium so interessiert haben.»
Im Fokus: die Sommerserie der Universität Basel
Das Format Im Fokus rückt junge Forschende in den Mittelpunkt, die zum internationalen Renommee der Universität beitragen. Während mehrerer Wochen stellen wir Akademiker*innen aus unterschiedlichen Fachrichtungen vor, die stellvertretend für die über 3000 Doktorierenden und Postdocs der Universität Basel stehen.