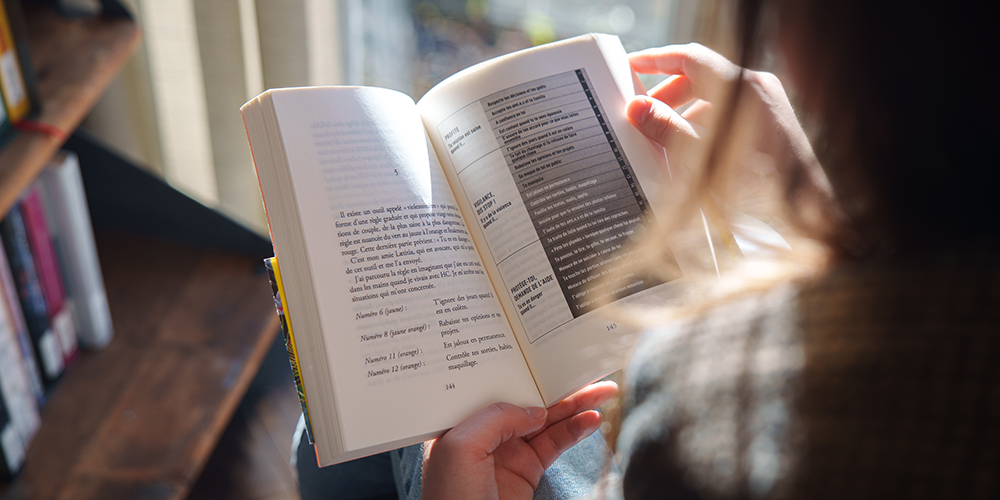Wie fast zwei Herzen stehen blieben: Mein Notfallpraktikum

Notfallpraktikum. Das Wort alleine löst bei mir schon ein gespanntes Kribbeln im Bauch aus. Sieht man da richtige Notfälle mit Ambulanz und Blut, Herzinfarkt, Schock, offene Wunden, Eiter und so? So ist es! Was ich in meinem Notfallpraktikum erlebt habe, wie man reanimiert und wie ich das alles verarbeite, liest du hier.
Im zweiten Studienjahr Medizin an der Universität Basel muss man ein Notfallpraktikum absolvieren. Drei Tage lang arbeite ich mit dem Pflegepersonal auf der Notfallstation zusammen. Diese drei strengen Schichten sind unglaublich eindrucksvoll und motivierend für das Studium.
Auf dem Weg zum Spital ist mir vor Aufregung fast schlecht und Gedanken à la «Wie war das nochmals mit dem EKG?» oder «Was ist ein normaler Hämoglobinwert?» schiessen mir wie kleine schmerzhafte Kugeln durch den Kopf. Was, wenn ich etwas falsch mache und ein Mensch stirbt? Ja, ich weiss, das ist völlig übertrieben und ich bin ein nervliches Wrack, ein Bündel überstrapazierter Nerven. Aber trotzdem, was wenn?
Meine Triage
Im Notfall angekommen wurde ich dann herzlich von den Notfallpflegerinnen (totale Frauenpower) in Empfang genommen, mit Kleidern ausgerüstet und kurz in die Organisation eingeführt; dann ging es los! Am ersten Tag durfte ich mit einer erfahrenen Notfallpflegerin mitlaufen, die mich während der ganzen Schicht immer wieder aufs Neue forderte: «Schau dir diesen Bauch an, was ist das? Aszites genau, wieso entsteht das?…» Meine Antworten waren natürlich nicht immer richtig, im Gegenteil, aber die Begeisterung über die Fälle diskutieren zu können und etwas Spannendes zu lernen, liessen mich schnell alle Hemmungen verlieren.
Ich musste Betten putzen, Kissen holen, aber auch Blutproben mit einem raffinierten Röhrensystem ins Labor schicken, EKGs anlegen, sie interpretieren (es auf jeden Fall versuchen), Differentialdiagnosen stellen, usw… Das sind alles Dinge, (ausgenommen vom Betten putzen und Kissen holen natürlich), die ich noch nie in meinem Leben machen durfte. Echt cool.
Ein kleiner Blutstropfen für die Menschheit, ein grosser Stich für mich
In jener Schicht kamen mehrere Ambulanzen: Ein Fall von Intoxikation auf Grund eines Suizidversuchs, ein vom Trottinett gestürzter, betrunkener Mann mit Verdacht auf eine Halswirbelfraktur und kurz vor Schluss kam noch ein alkoholisierter Patient auf den Notfall, der wahrscheinlich auch Rauschmittel konsumiert hatte. Er war so aggressiv, dass man ihn mit Hilfe von vier Securitas am Bett fixieren musste. Man musste ihm Blut abnehmen und jemand kam auf die glorreiche Idee, dass ja eine Praktikantin da sei, welche das doch üben könnte. Jetzt oder nie: Handschuhe anziehen, im Kopf das Procedere nochmals durchgehend, während der Patient mir ins Ohr brüllte: «Fuck you! Fuck you!» Tief einatmen, ansetzen, stechen; Blut floss. Erleichtert atmete ich auf und konnte nicht aufhören zu grinsen, während mein Trommelfell immer noch unablässig bearbeitet wurde. Der Wahnsinn.
Zweite Runde!
Am nächsten Tag konnte ich den Schichtbeginn kaum abwarten. Man erwartete am Nachmittag zwei Patienten mit Herzinfarkt, die man sogleich in die Koronarangiographie schicken wollte, um die verstopften Koronargefässe mit Stents zu öffnen. Mich schickte man gleich mit und die nächsten sechs Stunden stand ich in einem bleischweren Bleikittel in der «Koro», bestaunte die Schläuche sowie die Fingerfertigkeit des Kardiologen und stellte Fragen. Das ganze Wochenende lang, Fragen über Fragen.
Beim zweiten Patienten kam es während der Behandlung zu Komplikationen: Auf Grund der verschlechterten Herzfunktion entwickelte der Patient ein Lungenödem und fing an zu husten, bekam kaum mehr Luft. Man bestellte sofort die Anästhesie in die «Koro», damit man ihn intubieren und beatmen konnte. Genau in dem Moment, als das Anästhesistenteam den Operationssaal betrat, bekam der Patient noch dazu Kammerflimmern. Jetzt gab es nur noch eines zu tun: Herzmassage.
Fünf Personen waren vollauf beschäftigt damit zu intubieren, Medikamente zu spritzen, Zugänge zu legen, die Herzmassage durchzuführen, etc.. Jede Person im Raum wurde gebraucht, um das Leben des Patienten zu retten. Inklusive mir. Die Ärztin, die dem Patienten mit ihrer notwendigerweise kraftvollen Herzmassage bereits mehrere Rippen gebrochen hatte, drehte sich zu mir um und sagte: «Zieh dir Handschuhe an, du musst mich ablösen.» Ab da hatte ich keine Zeit mehr zu überlegen, ich musste einfach funktionieren. «Du löst mich ab in drei, zwei, eins!» Pumpen, pumpen, pumpen. Jemand sagte schneller, ein anderer tiefer. Pumpen: Schneller, tiefer. Ich drückte den Brustkorb jedes Mal um mehrere Zentimeter runter, meine Arme wurden schnell schwer. Doch ich konnte es mir nicht leisten darüber nachzudenken, was ich da eigentlich tat. Meine müden Muskeln mussten massieren. Der Schneller-Mensch fügte nach einer Weile hinzu: «Sehr gut.» Pumpen: Schneller, tiefer, sehr gut. Dann hörte ich wieder, dass mich jemand ablöst in drei, zwei, eins und ich trat vom Tisch zurück, war wieder Zuschauerin. Erst da bemerkte ich das Rauschen in meinen Ohren und meine zitternden Hände, jene Hände, die gerade ein Herz reanimiert hatten.
Der Patient konnte nach einer Viertelstunde Reanimation stabilisiert werden und wurde dann auf die Intensivstation gebracht. Ich begab mich wieder zurück auf den Notfall, wo alle Pflegerinnen mich sofort empfingen, umsorgten und nicht mehr alleine liessen. Ich sah wohl ein bisschen fertig aus, denn sie schickten mich eine Stunde vor Schichtende nach Hause. «Zünde dir zu Hause eine Kerze an, das hilft», gaben sie mir noch mit auf den Weg. Ein Licht in der Dunkelheit, Wärme, Hoffnung; ja, das hilft.
Aller guten Dingen sind drei
Am Sonntag fühlte ich mich schon richtig zuhause und wohl auf der Notfallstation, was sicher auch an der empathischen Umgebung mit den tollen Notfallpflegerinnen lag. Der Schock der Reanimation steckte mir jedoch noch tief in den Knochen. In der letzten Schicht durfte ich beim Vernähen einer offenen Wunde an der Stirn (ich meinte den Knochen erspähen zu können) noch dabei sein und die Ambulanz brachte eine Patientin mit Verdacht auf eine intrakranielle Blutung in den Schockraum, wo sie Kammerflimmern entwickelte und kurz reanimiert werden musste. Doch auch sie konnte stabilisiert werden.
Der Abschied von den warmherzigen, hart kämpfenden Menschen auf der Notfallstation fiel mir sehr schwer. Doch wer weiss, vielleicht komme ich eines Tages wieder zurück und hier zitiere ich eine Pflegerin: «Die Welt der Medizin ist sehr klein.»
Dieser Artikel erschien 2017 auf dem Beast-Blog der Universität Basel. Er wurde für Campus Stories aktualisiert. Josefin schrieb bis 2021 für den Beast-Blog.