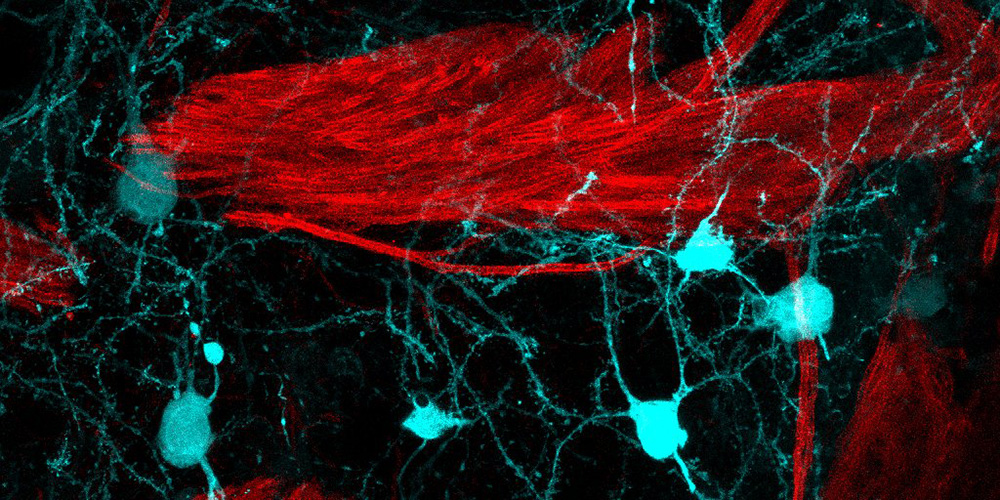Im Fokus: Chipo Mellisa Kaliofasi erforscht zwischen Basel und Simbabwe, wie Shona-Frauen um ihren Besitz kämpfen müssen
Chipo Mellisa Kaliofasi kam dank eines Stipendiums nach Basel und promoviert am Department Geschichte. Sie gehört dem Shona-Volk in Simbabwe an und erforscht die Erbschaftsgesetze und -praktiken für Shona-sprachige Frauen während der Kolonialzeiten. Dazu reist sie an die ländlichsten Orte ihres Heimatlandes.
31. Juli 2025 | Shania Imboden
Chipo Mellisa Kaliofasi steckt in den letzten Vorbereitungen. In wenigen Tagen reist die 30-Jährige nach Simbabwe, um vor Ort für ihre geschichtswissenschaftliche Dissertation zu forschen. Bevor die Reise losgeht, trifft sie sich mit Kolleginnen und Kollegen des Departements zum Abendessen. «Wir sind alle Freunde », betont sie. «Bereits bevor ich in die Schweiz gekommen bin, haben die Menschen hier mich unglaublich herzlich bei den Vorbereitungen unterstützt.»
Kaliofasi wuchs in Simbabwe als Angehörige des Shona-Volkes (vgl. Box) auf und schloss dort ihren Master ab. Nach der Coronapandemie war es für sie Zeit für einen Tapetenwechsel – raus in die Welt, nach Europa. Eigentlich sei sie schon dabei gewesen, alles vorzubereiten, um ihre Dissertation an einer deutschen Universität zu machen. Doch dann kam die Zusage aus Basel – und alles änderte sich.
Zwischen Basel und Simbabwe
In Basel fühlt sich die Forscherin sehr wohl: «Die Stadt hat mich alleine schon wegen ihres akademischen Rufs sehr angezogen und ich habe die Entscheidung, hier zu promovieren, nie bereut», so Kaliofasi. Auch wenn dies bedeutet, dass sie von ihrer Familie getrennt ist.
Die Doktorandin ist dreifache Mutter. Ihre Kinder und ihr Ehemann leben in Simbabwe und unterstützen sie von dort aus. Die Distanz sei eine Herausforderung, doch sie besuche ihre Familie sobald sie für ihre Feldforschung in ihrer Heimat sei. «Ich freue mich, dass ich meine Familie schon bald wiedersehen kann», erzählt sie kurz und spricht dann lieber wieder über ihre Arbeit.
Balanceakt der Gesetze und Traditionen
Während sie noch in Simbabwe als Forschungsassistentin arbeitete, wurde ihr zunehmend bewusst, dass die vordergründig gut dokumentierten wirtschaftlichen und politischen Krisen des Landes nur einen Teil der Realität abbilden. Darunter liegen tiefsitzende soziale Brüche und kulturelle Spannungen. «Mich treibt in meiner Forschung besonders der Wunsch an, metaphysische, spirituelle und strukturelle Ungleichheiten und die daraus resultierenden sozialen Konflikte zu verstehen und zu bekämpfen.»
Im Zentrum ihrer Forschung steht das Zusammenspiel von vorkolonialen Erbschaftspraktiken und den kolonialen Rechtssystemen, die mit der britischen Kolonialherrschaft eingeführt wurden. In ihrer Dissertation widmet sich Kaliofasi der Rolle der Shona-Frauen und -witwen im Umgang mit Besitz- und Erbrechtsfragen. Konkret untersucht sie, wie Shona-Frauen im kolonialen Simbabwe von 1896 bis 1980 versuchten, ihre Rechte und ihren Besitz zu sichern.
Viele der rechtlichen Strukturen und Denkweisen aus der Kolonialzeit wirken bis heute nach. Gleichzeitig bestehen traditionelle Erbschaftspraktiken fort, bei denen Spiritualität, familiärer Austausch und Rituale eine zentrale Rolle spielen. Besonders wichtig ist in der Kultur der Shona der Respekt vor dem Willen der Verstorbenen. «Wir glauben nicht daran, dass der Tod das Ende ist. Die Verstorbenen können noch immer mit den Hinterbliebenen kommunizieren und ihnen ihren Willen kundtun. Diesen gilt es zu respektieren.» Im traditionellen Glauben bringe ein erboster Geist jenen Hinterbliebenen Unglück, die seinen Willen missachten, so Kaliofasi.
Welche Erbschaftspraxis angewendet wird, ist je nach Situation der Familie unterschiedlich. «Es ist ein Balanceakt, den die Menschen damals wie heute bewältigen müssen», sagt die Forscherin.
Archiv, Erinnerung und Patriarchat
Die Rolle der Frau ist im simbabwischen Erbrecht stark vom Patriarchat geprägt – auf mehreren Ebenen. Auf Shona-Frauen – wie auch auf andere Shona-Personen – wirkten nicht nur koloniale Mächte, sondern zusätzlich das Patriarchat sowohl innerhalb der eigenen Kultur als auch in kolonialherrschaftlichen Ausprägungen. «Sie mussten versuchen, diese beiden patriarchalischen Kontexte zu navigieren», so Kaliofasi.
Diesen Sommer wird Kaliofasi ein weiteres Mal Archive in Simbabwe durchstöbern und Personen zu ihren Erfahrungen befragen. Weil die Archive in Simbabwe grösstenteils noch nicht digitalisiert sind, muss sie alle Schriften mit viel Zeitaufwand von Hand durchsuchen.
Geht es um die sozialen Strukturen und spirituellen Gebräuche des Landes, muss sich die Wissenschaftlerin hauptsächlich auf die mündlichen Überlieferungen der Shona-Frauen verlassen. Dafür reist sie innerhalb des Landes weit und besucht viele Dörfer, um dort von älteren Frauen und Häuptlingen deren Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln und mit dem Aufnahmegerät festzuhalten.
Kaliofasi erfährt nicht nur von familiären Unglücken, sondern auch von sich rächenden Geistern und anderen spirituellen Deutungen. Was die Frauen berichten, berührt sie immer wieder: «Ich höre sehr viele emotionale Geschichten. Viele Frauen haben durch Gesetze – sei es im Kontext der Kolonialisierung oder im Zuge von Shona-Traditionen – nach dem Tod ihres Ehemannes ihren ganzen Besitz verloren.»
Trotz der oft belastenden Inhalte schätzt sie den direkten Austausch mit den Menschen in Simbabwe. «Die Leute erzählen ihre Geschichten gerne», sagt sie und lächelt. Doch das Vertrauen auf mündliche Quellen bringt auch methodische Herausforderungen: Die Erzählungen sind natürlich subjektiv und gelegentlich kommt es zu Unstimmigkeiten – besonders bei genauen Daten und Jahreszahlen. Dennoch ergebe die Vielzahl an sich gleichenden Berichten ein insgesamt recht objektives Bild.
Forschung mit Haltung
Chipo Mellisa Kaliofasi ist es indes wichtig, nicht nur Fakten zu präsentieren. Sie will mit ihrer Arbeit die gesellschaftlichen und spirituellen Dynamiken in ihrem Heimatland aufzeigen und in die historische Forschung einbeziehen, wie kulturelle Systeme den Alltag der Menschen prägen.
Ihr gesamtes Forschungsprojekt ist von ihrem Interesse daran geprägt, wie sich diese Strukturen kritisch untersuchen und durch Wissenschaft und sinnvollen Dialog verändern lassen.
Das Shona Volk
Die Shona sind ein afrikanisches Volk mit eigener Sprache, das etwa 70 Prozent der Bevölkerung Simbabwes ausmacht. Ihre Kultur ist reich an Traditionen, der Mbende-Jerusarema-Tanz beispielsweise gehört zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe.
Traditionell basiert das Erbrecht der Shona auf der Zugehörigkeit zur Blutlinie, Besitz wird innerhalb dieser vererbt. Frauen heiraten in eine Blutlinie ein, gelten aber lebenslang als Gast. Verstirbt ihr Ehemann, haben sie keinerlei Erbanspruch. Bei Erbstreitigkeiten werden oft traditionelle Häuptlinge (chiefs) und N’anga (traditionelle Heilerinnen und Heiler) hinzugezogen, um mit den Verstorbenen zu kommunizieren, deren Wünsche den Hinterbliebenen mitzuteilen und so zu schlichten.
Die Shona sind ein sehr spirituelles Volk und pflegen die Verbindung zu ihren Ahnen. N’anga sind spirituelle Fachpersonen und zentrale Figuren in der spirituellen Kommunikation zwischen Verstorbenen und Lebenden. Sie werden bei Problemen wie Krankheiten oder Unglück konsultiert, da die Shona glauben, diese seien die Rache eines erbosten Geistes. Eine gängige Wahrsagemethode der N’anga ist das «Knochenwerfen», bei der die spontane Anordnung symbolischer Gegenstände gedeutet wird, um Botschaften der Ahnen oder anderer Geister zu empfangen.
Im Fokus: die Sommerserie der Universität Basel
Das Format Im Fokus rückt junge Forschende in den Mittelpunkt, die zum internationalen Renommee der Universität beitragen. Während mehrerer Wochen stellen wir Akademiker*innen aus unterschiedlichen Fachrichtungen vor, die stellvertretend für die über 3000 Doktorierenden und Postdocs der Universität Basel stehen.