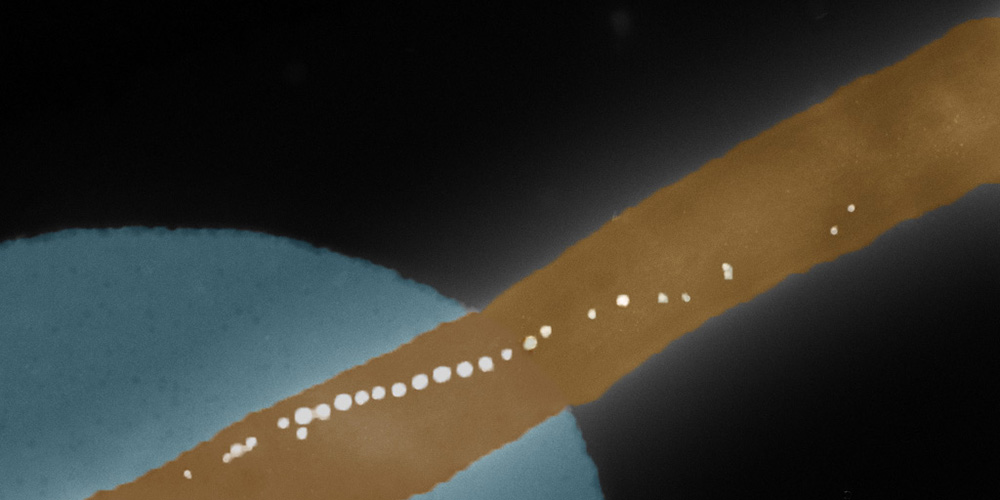100 Jahre Pharmaziemuseum: «Körperlichkeit, Krankheit und Heilung betreffen uns alle»
Mit einem Fest, einer Sonderausstellung und weiteren Events feiert das Pharmaziemuseum der Universität Basel sein 100-jähriges Bestehen. Sein Direktor, der Historiker Dr. Philippe Wanner, über Entstehung und Geschichte der Sammlung – und darüber, wie sie als modernes Museum bestehen will, ohne ihren historischen Charakter zu verlieren.
11. September 2025 | Christoph Dieffenbacher
Herr Wanner, erinnern Sie sich an Ihren ersten Besuch hier im Pharmaziemuseum?
Ja, das war während meines Studiums in einer Basler Museumsnacht, als ich das Angebot mit Freunden und Freundinnen ausprobieren wollte. Ich weiss nur noch, dass auch im Pharmaziemuseum beeindruckend viele Leute unterwegs waren und mich das Museum faszinierte. An Details erinnere ich mich nicht mehr.
Inzwischen kennen Sie die Sammlung sicher in- und auswendig. Welches ist denn heute Ihr Lieblingsobjekt?
Auch nach über zehn Jahren im Museum kenne ich lange noch nicht alle Objekte. Momentan ist es das sogenannte Eingangsbuch, ein grossformatiger Band, in dem Tausende von der Gründung bis zum Jahr 1992 aufgenommenen Objekte verzeichnet sind. Für fast jedes einzelne wurde vermerkt, woher und wie es ins Museum gekommen ist. Der Band ist eine spannende Quelle zu unserer eigenen Geschichte, die wir jetzt in einer Sonderausstellung aufbereitet haben. Aufschlussreich dabei ist auch, wie die Objekte damals beschrieben wurden, welchen Wert sie für die Sammlung ausmachten und welche Rolle sie für die Erzählung der Ausstellung spielen.
Die Sammlung erweckt den Eindruck eines Sammelsuriums. Wie ist daraus ein Museum entstanden?
Der Basler Apotheker und Universitätsdozent Josef Anton Häfliger hatte zu Hause eine Sammlung zur Pharmaziegeschichte angelegt. Er hielt Vorlesungen in Pharmaziegeschichte an der Pharmazeutischen Anstalt, also der Vorgängerin des Departements Pharmazeutische Wissenschaften, die sich bereits seit 1917 im selben Gebäudekomplex wie das etwas später gegründete Museum befand. Häfliger fehlte es in seinen Lehrveranstaltungen oft an Material für praktische Demonstrationen.
1925 schenkte er seine Sammlung der Universität, um die Objekte für den Unterricht zu erhalten. Zudem hatte mit der Industrialisierung der Medikamentenproduktion in der Pharmazie ein Umbruch eingesetzt. Es waren nicht mehr nur die Apotheken, die Tabletten und Salben herstellten, sondern vermehrt die grossen Fabriken. Das handwerkliche und wissenschaftliche Wissen um die Herstellung der Heilmittel in den Apotheken sollte durch die Objekte bewahrt werden.
Wie viele Museen wurde das Pharmaziemuseum also auf der Basis einer Privatsammlung gegründet. Haben Sie auch aktiv akquiriert?
Ja, und bis heute kann das Museum laufend Schenkungen entgegennehmen, von Einzelstücken bis zu ganzen Apothekeneinrichtungen. In den letzten Jahren sind etwa Objekte wie ein schwerer Destillierofen, Analysegeräte und eine Blistermaschine dazugekommen. Vor drei Jahrzehnten übernahm das Museum ein sehr umfangreiches Konvolut von Medikamentenwerbung, das momentan in die Sammlung aufgenommen wird. Solche Werbung ist ein interessanter Spiegel der Gesellschaft. Ab und zu können wir auch Ankäufe tätigen, wenn die Mittel dazu vorhanden sind.
Das Museum soll im Ganzen gut 50’000 Objekte besitzen, darunter überraschenderweise auch prähistorisches Material. Wie viel davon wird dauernd gezeigt, und wo ist der Rest gelagert?
Nach unseren Schätzungen sind es rund 4000 Einzelstücke, die in der Dauerausstellung zu sehen sind. Dieser Anteil ist im Vergleich zu anderen Museen äusserst hoch. Wir befinden uns hier in einer klassischen Lehrsammlung, die den Studierenden die Fülle ihrer Objekte zeigen will. Die nicht öffentlich gezeigten Objekte lagern fachgerecht in Kellern und anderen Räumen sowie in einem grösseren Aussendepot im Basler Gotthelfquartier.
Das Museum hat sich seit Jahrzehnten kaum verändert. Wurde da etwas verpasst?
Seit den 1930er-Jahren wurde nur wenig ausgetauscht oder ersetzt. Die Dauerausstellung hat sich ihren ursprünglichen Charakter bewahrt, was weitherum einmalig ist. Wir sehen uns als ein «Museum im Museum», als eines, das in sich ein museales Objekt darstellt. Der Museumsgründer wollten eine Fortschrittsgeschichte der Pharmazie zeigen, den Weg vom alten Handwerk zu einer naturwissenschaftlichen Disziplin. Heute versuchen wir, dieses lineare Denken zu relativieren und in einen neuen Kontext zu stellen. Wir wollen die historische Sammlung in einem zeitgemässen Rahmen präsentieren.
Wie machen Sie das?
Indem wir ergänzend zur Dauerausstellung immer wieder Sonderausstellungen zeigen und die Sammlung in öffentlichen Führungen, Audioguides, Workshops und Publikationen vermitteln. Ebenfalls betreiben wir Forschung – etwa über historische Arzneimittel – und untersuchen die Exponate mit interdisziplinären Methoden. Die Sammlung nun mit Bildschirmen und Lautsprechern vollzustellen, wäre falsch – das würde ihren Charme zerstören.
Welches waren die Höhepunkte und die Krisenzeiten des Museums?
Dass das Museum überhaupt zustande kam, war bestimmt ein erster Erfolg für Häfliger, die Apothekerschaft und die akademische Pharmazie. Gleich nach der Gründung fand ein vielbeachteter internationaler Kongress statt, der auch zur pharmaziehistorischen Forschung und zu weiteren Museen Anstoss gab. Zu einer Krise kam es in den 1970er-Jahren, als das Departement Pharmazie zeitweise von einer Schliessung bedroht war. Um 2000 wurde entschieden, von einer rein akademischen Sammlung wegzukommen und sich einem grösseren Publikum zu öffnen. Das originale Mobiliar der alten Barfüsser-Apotheke von 1900 wurde als Ganzes im Eingang des Museums eingebaut und zum Laden- und Kassenbereich umfunktioniert.
Körperlichkeit, Krankheit und ihre Heilung betreffen uns alle lebenslang.
Die Geschichte von Medizin und Pharmazie scheint ein grösseres Publikum anzuziehen. Wieso?
Ja, das Museum verzeichnet derzeit steigende Besucherzahlen. Körperlichkeit, Krankheit und ihre Heilung betreffen uns alle lebenslang. Die allermeisten Menschen haben einmal eine Arznei eingenommen. Über die Wirkung von Medikamenten wie auch von Naturheilmitteln wird diskutiert, wobei uns da und dort auch Vorstellungen begegnen, die weniger modern anmuten. Etwa wie bei Paracelsus im 16. Jahrhundert, der meinte, dass bestimmte Pflanzen deshalb heilend wirken, weil sie die Form und Farbe des erkrankten Körperteils haben, etwa der Augentrost. Seine Ansicht war übrigens schon damals umstritten.
Im Museum sind auch Amulette und heilende Kristalle, sogar ein ganzes Alchimistenlabor ausgestellt. Ist darunter auch der «Stein der Weisen», wie sich ein zeitgemässes Museum präsentieren soll?
Dieser Stein, der die Alchemisten umtrieb, ist nicht unbedingt materiell zu verstehen, sondern eher als ein Modus, eine Bewegung der Erkenntnis. In diesem Sinn wollen wir dem Publikum möglichst anschaulich an unseren Objekten und in unserer Forschung spannende Geschichten aus der Pharmazie erzählen. Wenn wir es dabei zum Staunen bringen, haben wir unseren «Stein der Weisen» gefunden.
Wo bereits Paracelsus wirkte
Das Pharmaziemuseum der Universität Basel beherbergt eine der weltweit grössten und bedeutendsten Kollektionen von Objekten der Pharmaziegeschichte. Es ist das einzige seiner Art in der Schweiz und umfasst im Wesentlichen eine naturwissenschaftliche Sammlung aus der Zeit um 1930. Untergebracht ist das Museum im Haus «Zum Vorderen Sessel» am Totengässlein 3. Hier wohnten und arbeiteten unter anderem die Buchdrucker Johannes Amerbach und Johannes Frobenius, auch Gelehrte wie Erasmus von Rotterdam und Theophrastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, gingen hier ein und aus.
Sein Jubiläum feiert das Pharmaziemuseum unter dem Motto 100 Jahre Sammeln, Forschen, Staunen bis Februar 2026 mit einer Reihe von öffentlichen Veranstaltungen. Offizieller Auftakt des Jubiläumsprogramms ist ein zweitägiges Fest am 20./21. September mit Workshops, Führungen, Bar, Tanzmusik und vielem mehr. In einer Sonderausstellung und einer Buchpublikation stellt das Museum seine eigene Geschichte vor und will dabei auch seine verborgenen Seiten zeigen.