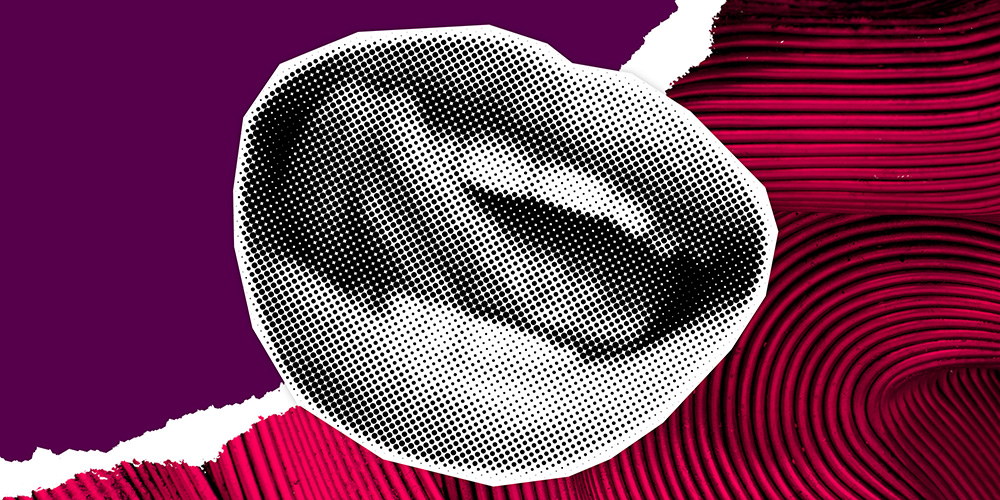Ersatz für fehlende Zähne.
Text: Christel Möller
Zahnimplantate sollen sich unauffällig ins Gebiss einfügen und dauerhaft halten. Wissenschaft auf der Suche nach dem besten Material dafür.
Jedem kann es passieren. Ein Unfall, Karies oder Entzündungen des Zahnbettes schädigen die Zahnwurzel. Der Zahn ist verloren, muss entfernt und durch ein Implantat ersetzt werden – allein in der Schweiz passiert das jährlich etwa 90 000 Mal. Mit der richtigen Pflege können solche Zahnimplantate mehr als zehn Jahre halten. Vorausgesetzt, es liegen keine Risikofaktoren wie Vorerkrankungen, schlechte Mundhygiene oder Rauchen vor.
Was allerdings im Kieferknochen genau passiert, nachdem jemand ein Implantat bekommen hat, ist zum grossen Teil noch unklar. Wie integriert das umliegende Knochen- und Weichgewebe den künstlichen Zahn? Welche Eigenschaften muss das Material besitzen, damit das Implantat möglichst lange hält – auch für Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter Wundheilung?
Um Fragen wie diese dreht sich die Forschung der beiden Wissenschaftlerinnen Géraldine Guex und Nadja Rohr vom Universitären Zentrum für Zahnmedizin in Basel (UZB). Sie untersuchen, wie sich verschiedene Implantatmaterialien, Beschichtungen und Oberflächen verhalten – unter Bedingungen, die denen im Mund sehr nahe kommen – und analysieren, wie die verschiedenen Zellen im Mund auf das Implantat reagieren.
Keramik als Alternative.
Ein Material im Fokus der beiden Forscherinnen ist Zirkoniumdioxid, eine Keramik-Alternative zu Titan. Aus Letzterem bestehen heutzutage rund 95 Prozent der Zahnimplantate. «Immer mehr Patientinnen und Patienten möchten aber eine metallfreie, noch ästhetischere Option für ihren Zahnersatz», erklärt die Zahnärztin Nadja Rohr. Denn das graue Titan fällt im Mund mehr auf als das weisse, keramische Zirkoniumdioxid. «Etwa fünf Prozent aller Implantate bestehen heute bereits aus Zirkoniumdioxid», beschreibt Nadja Rohr. Es gibt aber noch einiges über die Eigenschaften dieses keramischen Materials herauszufinden.
Die Forscherinnen wissen bereits, dass sich die Kristallstruktur von Zirkoniumdioxid unter Umständen verändern kann. «Wir analysieren, welchen Einfluss Temperatur, Feuchtigkeit oder Lagerung auf die Materialeigenschaften und auf das Zusammenspiel mit verschiedenen Zellen im Mund haben», sagt die Nanowissenschaftlerin Géraldine Guex.
Das Team von Nadja Rohr untersucht, wann und weshalb es zu diesen Strukturveränderungen kommt. Sie setzt dazu unter anderem einen Kausimulator ein, um die Bedingungen im Mund nachzuahmen. Darin können die Forschenden Temperaturen zwischen 5° und 55 °C einstellen: Das simuliert die Situation, wenn wir kalte oder heisse Getränke und Speisen zu uns nehmen.
Der Versuchsaufbau ahmt auch die Kaubewegung über mehrere Tage oder Wochen nach. Denn das untersuchte Material muss nicht nur verschiedene Temperaturen aushalten, sondern auch hohen Kaukräften widerstehen – durch die starke Kaumuskulatur müssen unsere Zähne Belastungen in der Grössenordnung von 100 Kilogramm standhalten.
Beste Oberfläche gesucht.
In einem aktuellen Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit einem Industriepartner und der Fachhochschule Nordwestschweiz untersuchen die Wissenschaftlerinnen die Eigenschaften von Zirkoniumdioxidproben. Das Rohmaterial stellt der Industriepartner zur Verfügung. Daraus fräst das Forschungsteam kleine Scheiben aus, poliert sie, behandelt sie gezielt mit Hitze und strukturiert so die Oberfläche im Nanometer-Massstab.
Diese Methode soll aktuelle Herstellungsprozesse vereinfachen und dem Implantat möglichst gute Eigenschaften verleihen. Während Nadja Rohr dabei Parameter des Materials wie Festigkeit, Rauheit oder Härte der verschiedenen Zirkoniumscheiben analysiert, untersucht Géraldine Guex, wie Zellen aus dem Mund auf die unterschiedlich behandelten Oberflächen der Scheiben reagieren. «Wir suchen nach optimalen Bedingungen für anhaftende Zellen des Knochens und des Zahnfleischs, damit sich das Implantat schnell und sicher integrieren kann. Allerdings wollen wir es entzündungsauslösenden Bakterien möglichst schwer machen, sich auf den Implantaten niederzulassen», erklärt sie.
Erste Ergebnisse aus vorgängigen Forschungsprojekten zeigen, dass eine scheinbar glatte, aber mit vielen winzigen Strukturen versehene Oberfläche gegenüber einer rauen, mikrostrukturierten Oberfläche diese Anforderungen besser erfüllt.
Um den Bedingungen im Mund noch näher zu kommen und besser beurteilen zu können, wie die Zellen auf unterschiedliche Materialien des Zahnersatzes reagieren, entwickelt Géraldine Guex zusammen mit einer Doktorandin des Swiss Nanoscience Institutes auch Methoden, Zellen in dreidimensionalen Konstrukten zu kultivieren.
«Wir betten hier die verschiedenen Zelltypen in ein fasriges Geflecht aus Polymeren ein und untersuchen, unter welchen Bedingungen sie wachsen oder sich differenzieren», beschreibt Géraldine Guex. Dies erlaube, die Zellphysiologie zu untersuchen und Reaktionen auf unterschiedliche Materialien unter verschiedenen Bedingungen besser zu verstehen. «Gegenüber den Tests mit isolierten Zelltypen auf zweidimensionalen Substraten hoffen wir, damit ein Bild zu erhalten, das die Realität im Mund deutlich besser widerspiegelt.»
Für die Zukunft möchte sie mit ihrem Team anhand derartiger Modelle Behandlungsmethoden entwickeln, die auch für Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter Wundheilung einen problemlosen Umgang mit Zahnimplantaten über viele Jahre hinweg ermöglichen. Denn aus welchen Gründen auch immer der ursprüngliche Zahn verloren ging, der Ersatz sollte im besten Fall ein Leben lang halten.
Nadja Rohr ist Lehrbeauftragte und leitet die Forschungsgruppe Biomaterialien und Technologie sowie den Bereich Zahntechnik am Universitären Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB).
Géraldine Guex ist Assistenzprofessorin für Orale Implantologie am Universitären Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB) und assoziierte Gruppenleiterin am Departement für Biomedizin der Universität Basel.
Weitere Artikel in dieser Ausgabe von UNI NOVA (Mai 2025).