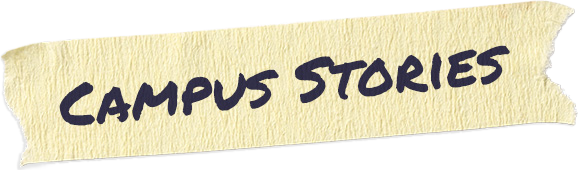12 points go to... University of Basel

Basel ist im ESC-Fieber: Die Stadt feiert mit bunten Herzen, Public Viewings und Konzerten die grösste Musikshow der Welt. Auch die Universität Basel ist auf das Eurovision-Drämmli aufgesprungen und widmet dem ESC auch Seminare und Vorlesungen.
Zwischen Eurovision Village, Square, Boulevard und Street verwandelt sich die Stadt in eine gigantische Bühne voller Farben und Stimmen. Doch nicht nur in der Innenstadt ist der ESC präsent – auch im Seminar «United by Music: Medienlinguistische Perspektiven auf den Eurovision Song Contest von den 1950er Jahren bis heute» unter der Leitung von Prof. Dr. Martin Luginbühl wird der ESC ins Scheinwerferlicht gerückt.
Für die Bachelor-Studierenden der deutschen Philologie Johanna Glowacki, Florence Remy und Charles Thormann stand fest: Wenn der ESC schon nach Basel zieht, bietet sich jetzt die ideale Gelegenheit, ihn aus sprach- und medienwissenschaftlicher Sicht genauer unter die Lupe zu nehmen.
Wissenschaft trifft Popkultur
Im Zentrum des Seminars steht der Eurovision Song Contest als mediales und kulturelles Grossereignis. Dabei geht es nicht nur um die Analyse von Songtiteln, sondern um das gesamte mediale und kommunikative Spektrum des Events: Moderation, Sprache, visuelle Gestaltung, Bühnenauftritt, Berichterstattung, Identität und Publikumskommentare werden analysiert.
Die Sitzungen sind durch Studierendenvorträge strukturiert – dabei entwickelt jede Gruppe eine eigene Fragestellung zum ESC und verknüpft diese mit theoretischen Konzepten aus der Medien- oder Sprachwissenschaft. «Besonders spannend war es, Theorie auf ein Phänomen anzuwenden, das in der Popkultur so relevant und zudem direkt vor Ort präsent ist», erklärt Florence. Die Präsentationen behandeln Themen wie Queerness, Genderrollen oder den gezielten Einsatz mehrerer Sprachen innerhalb eines Auftritts im Zusammenhang mit aktuellen und vergangenen ESC-Events.
Bühne frei für Europeanness
Florence, Johanna und Charles beschäftigten sich gemeinsam mit der Frage, wie nationale Identität und Europeanness beim ESC inszeniert werden. Dabei analysierten sie sowohl historische Beiträge wie den Auftritt der Pepe Lienhard Band von 1977 als auch aktuelle Beispiele: den diesjährigen Schweizer Auftakt mit Alphorn und Trachten, die Performance Schwedens sowie den Zwischeneinspieler «Made in Switzerland», der von den Moderatorinnen Hazel Brugger und Sandra Studer mitgesungen wurde.
«Im Seminar haben wir eine grosse Vielfalt an Medienformaten untersucht», erzählt Johanna. Dabei standen nicht nur sprachliche Elemente im Fokus, sondern auch multimodale Ausdrucksmittel. In ihrer Präsentation zeigten Florence, Johanna und Charles, wie vielfältig nationale Identität inszeniert werden kann: etwa durch den bewussten Einsatz von Landessprachen, traditionellen Instrumenten, Trachten oder visuellen Symbolen. Auffällig sei jedoch, dass solche Inszenierungen heute seltener geworden sind oder ironisch und selbstreflektiert eingesetzt werden. Stattdessen lasse sich eine Entwicklung beobachten, bei der nationale Bezüge zunehmend durch eine transnationale, europäische Zugehörigkeit ergänzt oder sogar überlagert werden – etwa durch gezielten Sprachwechsel oder Songs in einer anderen Landessprache, wie das Beispiel «Espresso Macchiato» aus Estland zeigt.
Mit geschärftem Blick auf Basel
Das Seminar ermöglicht den Studierenden nicht nur eine neue Perspektive auf den ESC, sondern auch ein tieferes Verständnis dafür, wie kulturelle Grossereignisse medial gestaltet und vermittelt werden – sowohl auf der grossen Bühne der Liveshow als auch im öffentlichen Raum der Stadt.
«Gerade in dieser Woche wird man als Pendler schon im Zug, am Bahnhof und später im 30er-Bus zur Uni von ESC-Durchsagen, Willkommensschildern und Personen in Merchandise-T-Shirts begrüsst», erzählt Charles. «Durch das Seminar achte ich jetzt viel bewusster auf solche Dinge – und erkenne schneller, welche Bedeutungen transportiert werden können», meint er.
Auch Johanna betont: «Dass der ESC dieses Jahr in Basel stattfindet, macht das Thema besonders greifbar – es liegt buchstäblich vor der Haustür.» Und genau darin liegt der besondere Reiz dieses Seminars: Wissenschaftlich reflektieren, was man mitten im Alltag selbst erlebt – und so einen neuen, tiefergehenden Blick auf ein Medienereignis dieser Grösse gewinnen.
Am Ende des Semesters gibt es für die Studierenden zwar keine 12 Punkte wie beim grossen ESC-Finale – stattdessen winken aber die altbewährten 3 Kreditpunkte und die Fachgruppe Deutsch organisiert ein gemeinsames Viewing des Finales als krönenden Abschluss.